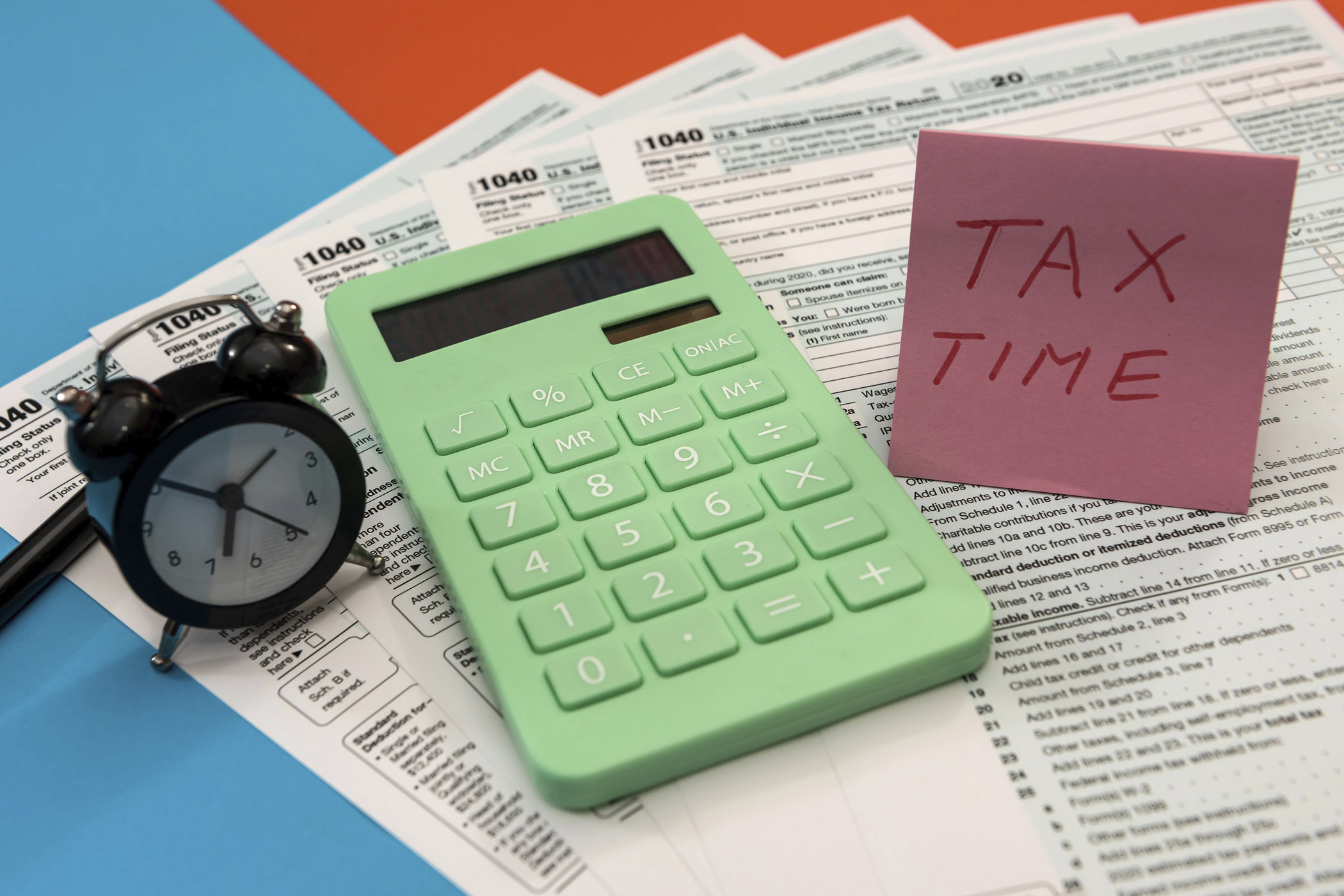Steuererklärung 2024: Tipps, um bares Geld zu sparen
An die alljährliche Steuererklärung denken die meisten Arbeitnehmer nur ungern. Und auch wenn sie dabei meistens Geld zurückerhalten, schieben sie die unliebsame Aufgabe gerne vor sich her. Worauf muss ich achten? Was kann ich alles geltend machen und an welchen Stellen ist Vorsicht geboten? Viele praktische Tipps, um Steuern zu sparen, liefert dieser Ratgeber.
Die Fristen: Wann muss ich meine Steuererklärung machen?
Selbstständige und Angestellte, die zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind, und diese Aufgabe selbst übernehmen, müssen sich an bestimmte Fristen halten. Bis 2019 galt als festes Datum immer der 31. Mai des Folgejahres. Durch die Corona-Pandemie hat sich diese Frist zeitlich nach hinten verschoben, soll nun aber sukzessive wieder angepasst werden (31. August 2024, 31. Juli 2025, 30. Juni 2026).
Wer mehr Zeit benötigt, ist mit einem Steuerberater oder dem Lohnsteuerhilfeverein gut beraten. Dank der professionellen Unterstützung gibt es einen Aufschub von sieben Monaten. Die Abgabe der Steuererklärung 2023 hat dabei Zeit bis zum 28. Februar 2025. Darüber hinaus kann sogar eine Fristverlängerung bis zum 31. Mai 2025 beantragt werden.
10 praktische Tipps für die Steuererklärung
Wer kein Geld verschenken, sondern am Ende sogar noch eine satte Rückzahlung erhalten will, achtet auf folgende Aspekte bei der Steuererklärung.
Tipp 1: Homeoffice-Pauschale
Personen, die daheim arbeiten, können die Homeoffice-Pauschale geltend machen. Diese beträgt 6 Euro pro Arbeitstag für maximal 210 Tage im Jahr. Maximal können daher 1.260 Euro geltend gemacht werden.
Tipp 2: Entfernungspauschale
Wer hingegen im Büro arbeitet, profitiert von der Entfernungs- beziehungsweise Pendlerpauschale mit 30 Cent pro Kilometer. Bei längeren Strecken gibt es ab 21 Kilometern pro Kilometer sogar 38 Cent. Die Pauschale wird unabhängig vom Verkehrsmittel gezahlt und gilt auch für Radfahrende und Fußgänger.
Tipp 3: Werbungskostenpauschale
Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, die Kosten für berufliche Anschaffungen mit einem Pauschalbetrag von 1.230 Euro (für 2023) geltend zu machen. Die Werbekostenpauschale gilt komplett ohne Nachweispflicht und unabhängig davon, ob es tatsächlich berufliche Aufwendungen gab.
Tipp 4: Umzugskosten absetzen
Personen, die berufsbedingt umziehen, können sämtliche Kosten, die mit dem Umzug in Verbindung stehen, bis zu einer Höhe von 886 Euro von der Steuer absetzen. Dazu gehören sogar die Anfahrtskosten für die Besichtigung der Wohnung oder die Kosten für den Makler. Wer privat umzieht, erhält immerhin einen steuerlichen Vorteil für das Umzugsunternehmen.
Tipp 5: Handwerkerleistungen
Wer Handwerker in den eigenen vier Wänden beauftragt hatte, kann die entstandenen Arbeits- und Lohnkosten mit einem Anteil von 20 Prozent ebenfalls von der Lohnsteuer absetzen. Maximal 1200 Euro pro Jahr sind (bei Gesamtkosten von 6000 Euro) drin. Wichtig zu wissen ist, dass die Materialkosten nicht darunter fallen.
Tipp 6: haushaltsnahe Dienstleistungen
Für eine Putzhilfe, die private Kinderbetreuung oder die Pflege eines privaten Angehörigen haben Beschäftigte die Option, die Kosten als sogenannte haushaltsnahe Dienstleistung abzusetzen. Auch hier beläuft sich der Abzug auf 20 Prozent und auf eine Gesamtersparnis von maximal 4000 Euro jährlich.
Tipp 7: Ausbildungsfreibetrag
Für die Kosten der Schul- und Berufsausbildung der eigenen Kinder gibt es den Ausbildungsfreibetrag. Dieser hat sich 2023 auf 1.200 Euro pro Kind und Jahr erhöht. Der Ausbildungsfreibetrag muss beim Finanzamt beantragt werden.
Tipp 8: Verpflegungspauschbetrag
Wer beruflich unterwegs ist, darf für Reisen von mindestens acht Stunden sogenannte Verpflegungspauschbeträge geltend machen. Bis zu 24 Stunden gilt ein Pauschbetrag von 14 Euro. Für volle 24 Stunden werden 28 Euro veranschlagt.
Tipp 9: Sparerfreibeträge
Zinserträge aus Kapitalanlagen sind bis zu einem Betrag von (seit 2023) 1000 Euro steuerfrei. Für Verheiratete gilt in der Summe die Höchstgrenze von 2000 Euro.
Tipp 10: außergewöhnliche Belastungen
Wer Kosten für die eigene Gesundheit aufbringt, die die Krankenkasse nicht übernimmt, hat die Möglichkeit, diese als außergewöhnliche Belastungen bei der Steuer zu veranschlagen. Das können zum Beispiel Kosten für Zahnersatz, Brillen oder Medikamente sein. Möglich ist das allerdings nur, wenn zuvor ein zumutbarer Eigenanteil abgezogen wurde. Dessen Höhe hängt vom eigenen Einkommen und der Anzahl der Kinder ab und variiert zwischen einem und fünf Prozent der Einkünfte.
Urheber des Titelbildes: alfexe/ 123RF Standard-Bild