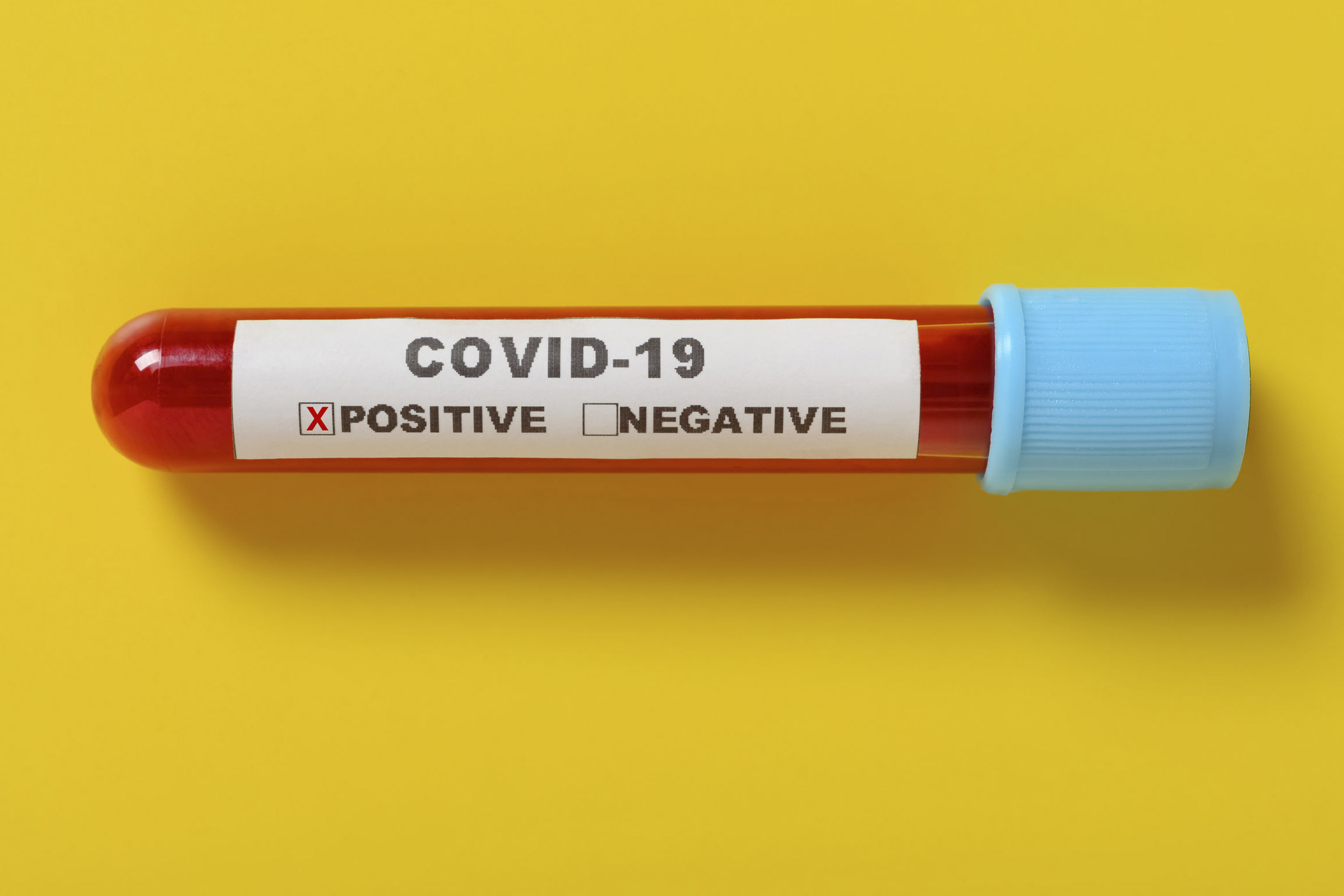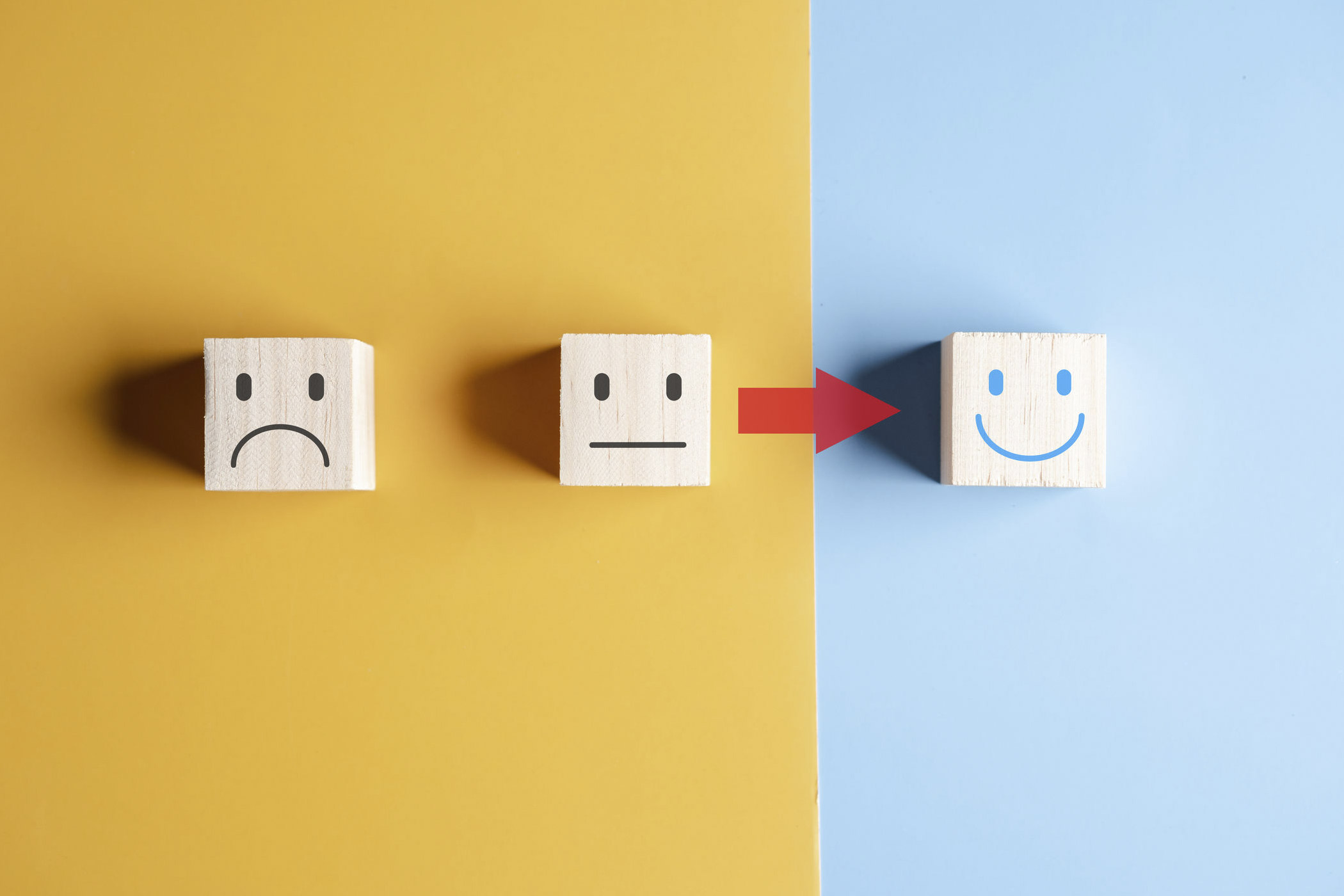Ereignislose Tage im Büro sinnvoll nutzen
Nicht viel los im Büro? Sind die Kollegen oder die Vorgesetzten im Urlaub und haben Sie alle wichtigen Aufgaben bereits erledigt? Leerlauf können Sie natürlich dazu nutzen, die Ablage zu sortieren, die Kugelschreiber nach Farbe zu ordnen oder Katzenvideos im Internet anzuschauen. Auf Dauer wird aber auch das ziemlich langweilig.
In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie ereignislose Tage im Büro auf produktive Weise füllen.
1. Ordnung schaffen
An stressigen Arbeitstagen bleibt vieles liegen. Bei Leerlauf bietet es sich daher an, endlich etwas Ordnung zu schaffen. Misten Sie Schreibtisch, Rollcontainer und Regale aus und entsorgen Sie, was Sie nicht mehr brauchen.
Löschen Sie alte, nicht mehr benötigte E-Mails aus ihrem Posteingang, räumen Sie Ihren Desktop auf und prüfen Sie, auf welche Smartphone-Apps Sie verzichten können. Vom alten Ballast befreit können Sie in der nächsten hektischen Phase unbeschwerter durchstarten.
2. Netzwerken
Ruhige Tage im Büro können Sie hervorragend dazu nutzen, Ihr Netzwerk zu pflegen. Vielleicht hat sich ein Stapel an Visitenkarten von Leuten angesammelt, mit denen Sie unbedingt in Kontakt bleiben wollten, aber nie die Zeit dafür hatten.
Schreiben Sie diese Personen doch einmal unverbindlich an. Gehen Sie auch Ihre Xing- und LinkedIn-Kontakte durch und schreiben Sie Leute an, bei denen Sie sich schon längst einmal melden wollten. Bei der Gelegenheit können Sie gleich Ihr Profil auf den neuesten Stand bringen.
3. Branchentrends recherchieren
Im Arbeitsalltag geht der Blick fürs Ganze schnell verloren. Was tut sich eigentlich in der eigenen Branche? Womit beschäftigt sich die Konkurrenz? Welche Trends machen gerade von sich reden?
Ereignislose Tage im Büro bieten die ideale Gelegenheit, um genau das herauszufinden. Machen Sie sich schlau, lesen Sie Branchen-Newsletter, recherchieren Sie in den sozialen Medien. Eventuell entdecken Sie Trends, die Ihr Unternehmen nicht verpassen sollte.
4. Die Karriereplanung vorantreiben
Einen langweiligen Tag im Büro können Sie auch nutzen, um Ihre Karriereplanung zu überdenken. Sind Sie noch zufrieden mit Ihrer Arbeitsstelle? Wo sehen Sie sich in einem, in zwei oder in fünf Jahren? Was muss sich ändern, damit Sie Ihre Ziele erreichen?
Um Ihre Karriere voranzutreiben, lohnt es sich, eine Übersicht der vergangenen Erfolge zusammenzustellen. Haben Sie wichtige Kunden gewonnen, ein großes Projekt erfolgreich abgeschlossen, Vorträge gehalten?
Selbst wenn Sie sich nicht nach einer neuen Stelle umsehen – eine solche Liste der eigenen Erfolge kann sehr sinnvoll sein, zum Beispiel bei der nächsten Gehaltsverhandlung.
5. Etwas Neues lernen
Dauert der Leerlauf länger an, nutzen Sie die Zeit doch für Ihre persönliche Weiterbildung. Schauen Sie sich TED-Talks zu interessanten Themen an, hören Sie Podcasts oder lesen Sie Fachartikel. Wollten Sie schon immer mal eine neue Sprache lernen, haben aber die Zeit dafür gefunden? Dann ist jetzt der Moment gekommen!
Planen Sie größere Weiterbildungsmaßnahmen, können Sie sich an ereignislosen Tagen nach entsprechenden Angeboten und Fördermöglichkeiten umsehen.
6. Kreativ werden
Langeweile eignet sich optimal, um kreativen Gedanken freien Lauf zu lassen. Schwebt Ihnen zum Beispiel eine Projektidee im Kopf herum, Sie hatten aber nie die Gelegenheit, diese zu konkretisieren?
Dann veranstalten Sie nun einmal ein Brainstorming mit sich selbst und erstellen ein kurzes Konzept. So entwickelt sich aus einem faden Tag heraus vielleicht ein vollkommen neues Projekt.
7. Kollegen unter die Arme greifen
Fällt Ihnen gar nichts mehr ein, um die Zeit totzuschlagen, fragen Sie einfach mal Kollegen aus anderen Teams oder Abteilungen, ob sie Unterstützung benötigen. Zeigen Sie Hilfsbereitschaft, gewinnen Sie damit nicht nur an Beliebtheit und verbessern das Betriebsklima, sondern lernen eventuell noch etwas dazu.
Urheber des Titelbildes: Elnur/ 123RF Standard-Bild