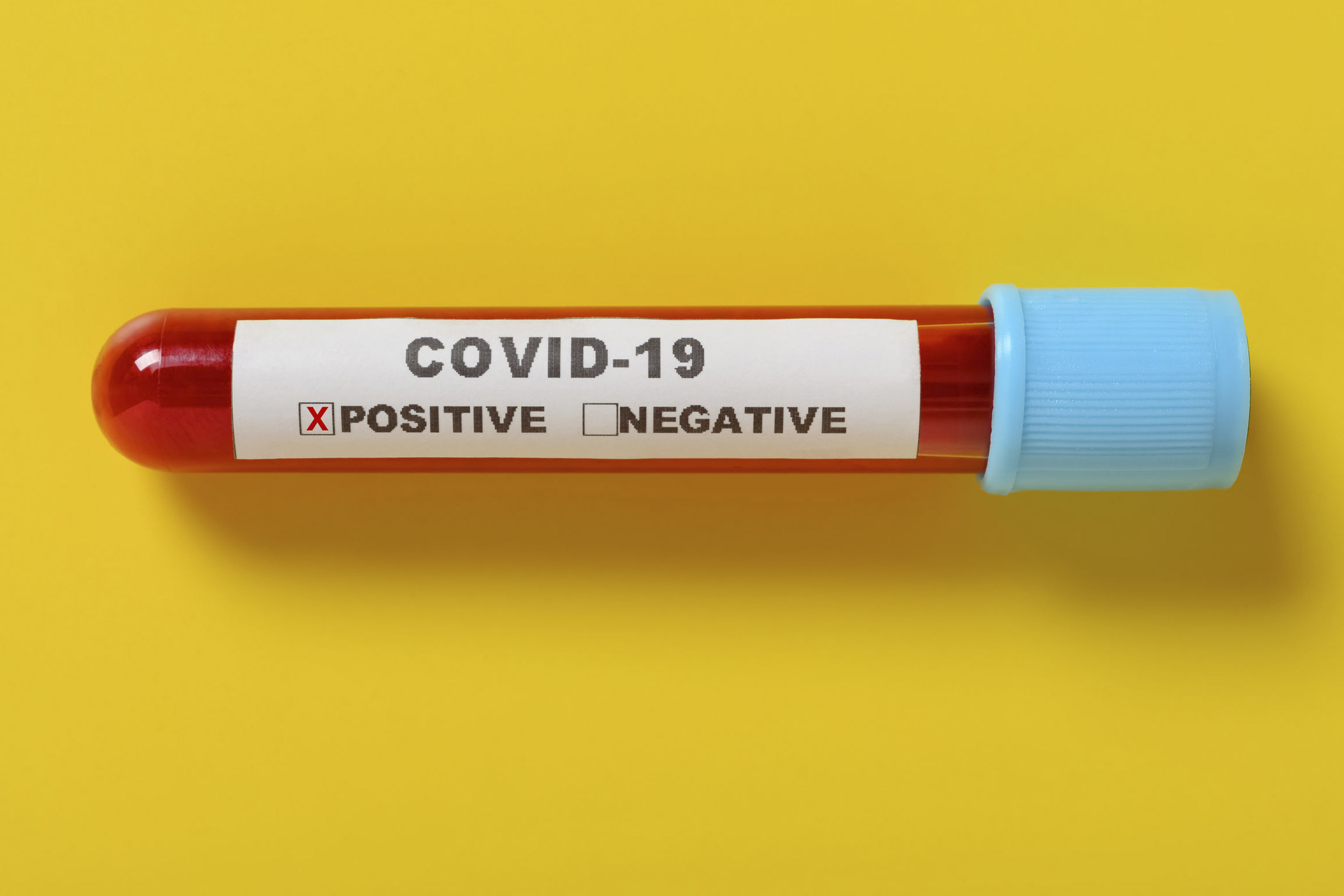Dass die Kollegin bereits um 7.35 Uhr am Schreibtisch sitzt, obwohl der Arbeitstag offiziell erst um 8 Uhr beginnt, ist längst zu einem gewohnten allmorgendlichen Bild geworden. Aber zählt diese Zeit überhaupt als Arbeitszeit? Und darf man einfach früher loslegen, ganz ohne Absprache mit dem Arbeitgeber? Warum manche gerne früher anfangen Frühes Erscheinen im BüroContinue reading Zu früh im Büro: Zählt das als Arbeitszeit?
Wenn der Bildschirm schwarz bleibt: Muss Arbeit nachgeholt werden?
Ein technischer Ausfall kann den Arbeitsalltag abrupt zum Stillstand bringen. Ob in der Firmenzentrale oder im heimischen Büro – wenn der Server nicht mehr reagiert, das Internet ausfällt oder das System hängt, steht oft nicht nur der Bildschirm still, sondern der gesamte Betrieb. Doch was bedeutet das für die Arbeitszeit? Müssen ausgefallene Stunden nachgeholt werdenContinue reading Wenn der Bildschirm schwarz bleibt: Muss Arbeit nachgeholt werden? →
Kündigungsschutz: Wer ist geschützt, wer nicht?
Ein Arbeitsverhältnis kann sich schnell verändern – und das nicht immer freiwillig. Wer gekündigt wird, steht oft vor vielen Fragen. Der gesetzliche Kündigungsschutz bietet in bestimmten Fällen Rückhalt. Doch nicht jede Kündigung ist automatisch unzulässig, und nicht jeder Job ist gleichermaßen geschützt. Wann das Kündigungsschutzgesetz greift Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) schützt Beschäftigte vor sozial ungerechtfertigten Kündigungen.Continue reading Kündigungsschutz: Wer ist geschützt, wer nicht? →
Kann man im Homeoffice abgemahnt werden? Zwischen Flexibilität und Arbeitsrecht
Für viele Beschäftigte ist das Arbeiten von zu Hause eine perfekte Mischung aus Freiheit und Produktivität. Doch trotz der vermeintlichen Lockerheit lauern im Homeoffice auch Fallstricke – darunter auch die unangenehme Möglichkeit einer Abmahnung. Homeoffice ist kein rechtsfreier Raum Wer denkt, im Homeoffice gelte ein Sonderstatus ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen, der irrt. Nur weil der SchreibtischContinue reading Kann man im Homeoffice abgemahnt werden? Zwischen Flexibilität und Arbeitsrecht →
Kann man im Homeoffice abgemahnt werden? Zwischen Flexibilität und Arbeitsrecht
Für viele Beschäftigte ist das Arbeiten von zu Hause eine perfekte Mischung aus Freiheit und Produktivität. Doch trotz der vermeintlichen Lockerheit lauern im Homeoffice auch Fallstricke – darunter auch die unangenehme Möglichkeit einer Abmahnung. Homeoffice ist kein rechtsfreier Raum Wer denkt, im Homeoffice gelte ein Sonderstatus ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen, der irrt. Nur weil der SchreibtischContinue reading Kann man im Homeoffice abgemahnt werden? Zwischen Flexibilität und Arbeitsrecht →
Digital Detox im Urlaub – zwischen Jobpflicht und Erholungsrecht
Die Koffer sind gepackt, das Flugzeug startet in wenigen Stunden gen Süden und noch vor dem Abflug kommt die erste Mail: „Kurze Rückfrage …“. Für viele beginnt der Urlaub mit digitalem Ballast. Dabei schützt das Gesetz die Erholung – wenn man sie denn selbst zulässt. Urlaubsanspruch: Erholung ist kein Wunsch, sondern Pflicht In Deutschland regeltContinue reading Digital Detox im Urlaub – zwischen Jobpflicht und Erholungsrecht →
Nicht gut weggekommen: Was tun bei ungerechter Bewertung im Arbeitszeugnis?
Mitarbeiter XY erledigte seine Aufgaben zu unserer Zufriedenheit und war stets bemüht in der kollegialen Zusammenarbeit … Sätze wie diese im Arbeitszeugnis gleichen einer Ohrfeige und sind nichts anderes als eine richtig schlechte Bewertung, die die Jobsuche wahrscheinlich deutlich erschwert. Arbeitnehmende, die sich ungerecht bewertet fühlen, müssen ihr Arbeitszeugnis nicht einfach hinnehmen. Schlechtes Arbeitszeugnis: Diese FormulierungenContinue reading Nicht gut weggekommen: Was tun bei ungerechter Bewertung im Arbeitszeugnis? →
Smartphone aufladen am Arbeitsplatz: Darf ich das?
Um ein Smartphone mit neuer Energie zu versorgen, ist nicht viel zu tun: das Gerät ans Ladegerät anschließen und ab damit in die Steckdose, fertig. Da das Aufladen des Handys im Grunde nebenbei passiert, erledigen dies viele Arbeitnehmer im Büro. Aber ist das eigentlich erlaubt? Die Ausgangslage: Handy mit Strom versorgen Die Situation kennen vieleContinue reading Smartphone aufladen am Arbeitsplatz: Darf ich das? →
Long Covid und die Folgen für die Arbeitswelt
Der Beginn der Covid-19-Pandemie liegt mittlerweile fünf Jahre zurück. Noch immer gehen allerdings einige Varianten des Sars-CoV-2-Virus um. Zudem leiden einige Menschen selbst Monate oder gar Jahre nach der Ansteckung noch an Symptomen wie chronischer Erschöpfung, kognitiven Einschränkungen oder Atemproblemen. In diesen Fällen spricht man von Long Covid. Betroffene sind weniger einsatzfähig, oft über einenContinue reading Long Covid und die Folgen für die Arbeitswelt →
Wer fliegt zuerst und wer darf bleiben? Die Kriterien der Sozialauswahl
25 Jahre Betriebszugehörigkeit, drei Kinder unter 18 und noch dazu noch ein Alter jenseits der 50 sind perfekte Voraussetzungen, um bei einer betriebsbedingten Kündigung zu den Glücklichen zu gehören, die bleiben dürfen. Eine wichtige Rolle spielt jetzt die Sozialauswahl. Die Ausgangssituation: Wann greift überhaupt eine Sozialauswahl? „Es tut uns sehr leid! Die Inflation und dieContinue reading Wer fliegt zuerst und wer darf bleiben? Die Kriterien der Sozialauswahl →
Liebesurlaub im Job: Darf der Partner mit auf die Dienstreise?
Wenn uns der Job nach Paris, London oder gar nach New York führt, kann der Partner schon mal neidisch werden. Dabei muss der oder die Liebste gar nicht unbedingt zu Hause bleiben. Mit der richtigen Planung und Absprache ist es durchaus möglich, die Dienstreise mit dem privaten Urlaub zu verbinden. Welche Regelungen gelten für denContinue reading Liebesurlaub im Job: Darf der Partner mit auf die Dienstreise? →