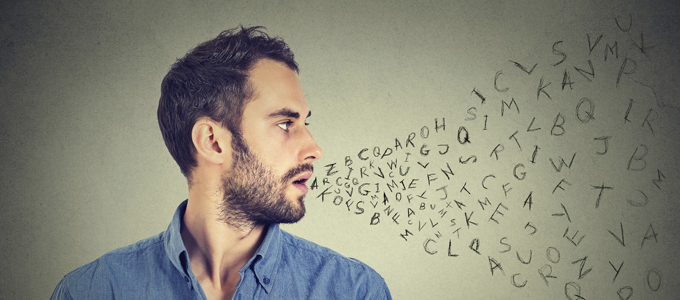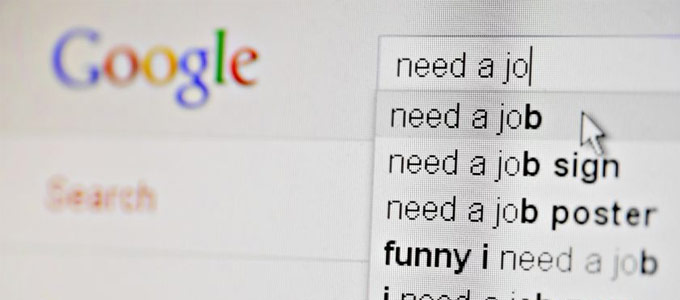Wird Ihnen ein langjähriges Arbeitsverhältnis gekündigt oder gehen Sie frühzeitig freiwillig in Rente, erhalten Sie eine Abfindung. Dabei handelt es sich um eine Geldsumme, die als Entschädigung gezahlt und u.a. von der Dauer der Betriebszugehörigkeit abhängig gemacht werden kann. In vielen Fällen wird um die Höhe der Abfindung lange gestritten. Das ist auch verständlich, daContinue reading So verhandeln Sie eine faire Abfindung
Networking: 4 Tipps, die wirklich helfen
Networking – auf Deutsch netzwerken – ist im Geschäftsleben unverzichtbar. Ob Sie sich erst noch einen Namen machen wollen oder es darum geht, Ihre Stellung auszubauen: Ein breit gefächertes Netzwerk macht vieles leichter und ermöglicht so manchen Karriereschritt. Hier sind vier Networking-Tipps, mit denen Sie im Berufsleben vorankommen. Gründen Sie Ihr Netzwerk Messen, Seminare,Continue reading Networking: 4 Tipps, die wirklich helfen →
Anreize im Job: Das Gehalt ist nicht alles
Verdienst, Urlaubsanspruch, Sicherheit, Work-Life-Balance: Eine aktuelle Umfrage zeigt, welche Anreize im Job Arbeitnehmer für besonders wichtig halten. Die Ergebnisse der Befragung belegen einmal mehr: Geld ist nicht alles – auch nicht im Berufsleben. 1.250 Arbeitnehmer in Deutschland befragt Was macht ein Unternehmen für Arbeitnehmer besonders interessant, welche Faktoren stehen ganz oben? Antworten liefert dieContinue reading Anreize im Job: Das Gehalt ist nicht alles →
Kleiner Ratgeber – Small Talk-Situationen im Job gekonnt meistern
Wer ein Meister des Small Talk ist, dem öffnen sich in unterschiedlichsten Lebensbereichen buchstäblich Tür und Tor. Durch gekonnten Small Talk ist es oftmals sogar möglich, neue Kontakte zu knüpfen, die vielleicht auch neue Chancen und Möglichkeiten im Berufsleben eröffnen. Small Talk im Privatleben unterscheidet sich meist stark von der „kleinen“ Unterhaltung im Job. UnterContinue reading Kleiner Ratgeber – Small Talk-Situationen im Job gekonnt meistern →
Berufliche Weiterbildung: Anspruch auf Bildungsurlaub nutzen
Die meisten Arbeitnehmer haben Anspruch auf Bildungsurlaub – unabhängig von ihrem gesetzlichen Urlaubsanspruch. Wie genau die Regelungen aussehen und wie sich Bildungsurlaub beantragen lässt – hier erfahren Sie mehr. Bildungsurlaub muss relevanten Nutzen haben Die allermeisten Arbeitnehmer lassen ihren Bildungsurlaub verfallen. Weniger als fünf Prozent der Beschäftigten in Deutschland nutzen ihr Recht auf Bildungsfreistellung,Continue reading Berufliche Weiterbildung: Anspruch auf Bildungsurlaub nutzen →
Ist der Job was für mich? Die 7 besten Bewerberfragen im Vorstellungsgespräch
Ein Vorstellungsgespräch ist keine einseitige Angelegenheit. Spätestens wenn ein Bewerber in der engeren Auswahl ist, sollte er dem einstellenden Unternehmen auf den Zahn fühlen. Doch auch aus einem weiteren Grund lohnen sich gezielte Rückfragen an den Personalchef oder potenziellen neuen Vorgesetzten: Interesse an der neuen Stelle und dem Unternehmen kommen gut an. Wir stellen dieContinue reading Ist der Job was für mich? Die 7 besten Bewerberfragen im Vorstellungsgespräch →
Karriere-Podcasts: Hörtipps fürs Arbeitsleben
Ob auf dem Arbeitsweg, beim Joggen oder Lümmeln auf dem Sofa: Podcasts bieten die Möglichkeit, Entspannung und Nützliches unter einen Hut zu bringen. Wer regelmäßig informative Karriere-Podcasts hört, bekommt hilfreiche Tipps fürs Arbeitsleben. Diese Podcasts sind besonders empfehlenswert. Xing Talk Hier geben Experten Tipps rund ums Thema Arbeitswelt. Ob Arbeitszeugnisse, Ergonomie am Arbeitsplatz oderContinue reading Karriere-Podcasts: Hörtipps fürs Arbeitsleben →
Körpersprache im Meeting: So treten Sie selbstbewusster auf
Die Körpersprache verrät mehr über uns als die Worte, die wir von uns geben. Dabei versteht unser Gegenüber die Signale unseres Körpers ganz automatisch, ohne sie bewusst zu analysieren. Die gute Nachricht: Gestik und Mimik lassen sich trainieren. Im geschäftlichen Bereich ist es von Vorteil, sich seiner Körpersprache in Meetings bewusst zu sein und sieContinue reading Körpersprache im Meeting: So treten Sie selbstbewusster auf →
Die beliebtesten kaufmännischen Ausbildungsberufe
Wer eine Ausbildung als Start der beruflichen Laufbahn in Erwägung zieht, hat dafür mehrere Möglichkeiten. Je nach Interesse kann eine Ausbildung im technischen Bereich oder im Handwerk erfolgen. Fehlt das handwerkliche Geschick oder die Affinität zu technischen Themen, bietet sich eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich an. Hier hat man die Möglichkeit, einen zukunftsorientierten und abwechslungsreichenContinue reading Die beliebtesten kaufmännischen Ausbildungsberufe →
Tiefstapelei: Hindernis für die Karriere?
Bei der Arbeit treffen oft viele Charaktere aufeinander, die schwer einzuschätzen sind. Selbstbewusste und Schüchterne „verkaufen“ sich und ihre Arbeitsleistung sehr unterschiedlich. Nicht alle Personalverantwortliche und Vorgesetzte sind in der Lage zu erkennen, welche Fähigkeiten, Kompetenzen und Leistungen sich hinter der offensichtlichen Fassade verstecken. „Schaumschläger“ überdecken beispielsweise mit ihrem lauten Verhalten oft die stillen Arbeitsbienen,Continue reading Tiefstapelei: Hindernis für die Karriere? →
Business-Lunch: Tipps für ein gelungenes Geschäftsessen
Das mittägliche Geschäftsessen läuft in einem entspannteren Rahmen ab als das abendliche Dinner. Trotzdem lauern auch beim Business-Lunch einige Fallstricke – mit diesen Dos und Don’ts sind Sie auf der sicheren Seite. Die Auswahl des Lokals Am Anfang des Business-Lunchs steht die Frage nach dem Treffpunkt. Der Vorschlag, wo man sich trifft, kommt dabeiContinue reading Business-Lunch: Tipps für ein gelungenes Geschäftsessen →
Soft Skills – Soziale Kompetenz im Job
Der Begriff „Soft Skills“ hat sich in den letzten Jahren im Arbeitsleben etabliert. Wer sich auf einen neuen Job bewirbt, trifft spätestens dann auf die wohl bekanntesten Vertreter der „weichen“ Fähigkeiten: Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Wie wir festgestellt haben, gibt es unzählige weitere persönliche Eigenschaften, die heutzutage – mal mehr, mal weniger – notwendig sein sollen,Continue reading Soft Skills – Soziale Kompetenz im Job →
Was sollten Sie bei einer beruflichen Neuorientierung beachten?
Zunächst ist es wichtig herauszufinden, welchen Grad Ihre Unzufriedenheit im Job bereits erreicht hat. Eine temporär auftretende Lustlosigkeit ist kaum einem Angestellten fremd und sicherlich allein noch kein triftiger Grund für eine Kündigung. Da die Frustrationstoleranz bei jedem Menschen unterschiedlich ausfällt ist es schwierig, allgemeingültige Aussagen darüber zu treffen, wann eine berufliche Neuorientierung notwendig bzw.Continue reading Was sollten Sie bei einer beruflichen Neuorientierung beachten? →
Humble Consulting: Problemlösung auf die einfühlsame Art
Wenn ein Mitarbeiter Hilfe sucht, befindet er sich oft in einer prekären Situation. Wird er dann unsensibel behandelt, verliert er schnell das Vertrauen in sein Gegenüber. Die Humble-Consulting-Methode des US-Psychologen Edgar Schein setzt deshalb auf einen persönlichen Draht zwischen dem betroffenen Mitarbeiter und dem, der ihn berät. Vertrauen als Kommunikationsstrategie Jemanden in einer persönlichenContinue reading Humble Consulting: Problemlösung auf die einfühlsame Art →
Challenge Management: Schwergewichtige Business-Tipps von Wladimir Klitschko
Waldimir Klitschko ist ein Phänomen. Während sich viele andere Profiboxer ausschließlich auf ihren Sport konzentrieren und auch abseits des Sports eher einen eindimensionalen Eindruck hinterlassen, ist „Dr. Steelhammer“ – so lautete sein Kampfname – äußerst vielseitig. Schon oft hat er bewiesen, dass er auch außerhalb des Boxrings viele Talente besitzt. Sein neuestes Projekt trägt denContinue reading Challenge Management: Schwergewichtige Business-Tipps von Wladimir Klitschko →
Studie zeigt: So kann man junge Mitarbeiter binden
Hochqualifizierte junge Arbeitnehmer sind in ihrem ersten Job häufig unzufrieden. Viele Arbeitgeber versäumen es, junge Mitarbeiter zu binden, weil ihnen gar nicht bewusst ist, worauf Berufseinsteiger wirklich Wert legen. Die meisten Berufsneulinge fühlen sich nicht unterbezahlt, sondern unterfordert. Junge Mitarbeiter erfolgreich zu binden hat viel mit Lob und Anerkennung zu tun. Junge Mitarbeiter bindenContinue reading Studie zeigt: So kann man junge Mitarbeiter binden →
Fremdsprachen aufpolieren und karrieretechnisch durchstarten
Mit Blick auf die Globalisierung sind Fremdsprachenkenntnisse im Job heute unerlässlich. In der Tat ist die Internationalisierung in vollem Gange. Kleine, mittelständische und große Unternehmen weltweit sind immer besser miteinander vernetzt. Auf dieser Basis sind im Laufe der vergangenen Jahre Synergien entstanden, die noch vor wenigen Jahrzehnten in der Form überhaupt nicht möglich gewesen wären.Continue reading Fremdsprachen aufpolieren und karrieretechnisch durchstarten →
Google for Jobs – wie funktioniert’s?
Wer einen neuen Job sucht, nimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Hilfe von Google in Anspruch. Das ist nicht überraschend, denn schließlich „googelt“ man heutzutage nach allen möglichen Informationen. Aktuell spuckt die deutsche Version der Suchmaschine bei einer Anfrage, z.B. nach „Jobs in Hamburg“, folgende Ergebnisse aus: Werbeanzeigen (AdWords), Organische Suchergebnisse, Werbeanzeigen (AdWords) Ähnliche Suchanfragen.Continue reading Google for Jobs – wie funktioniert’s? →
Studie: Mehr Gehalt oder mehr Urlaub – was ist Jobsuchenden wichtiger?
Ist das Gehalt alles entscheidend, oder nehmen Bewerber für ein positives Arbeitsumfeld sogar Abstriche beim Einkommen in Kauf? Dieser Frage ist das Forsa-Institut im Auftrag der HIH Real Estate nachgegangen. Das wichtigste Ergebnis der Umfrage vorweg: Die Entscheidung zwischen mehr Geld oder mehr Urlaub fällt eindeutig zugunsten der freien Tage und anderer weicher Faktoren aus.Continue reading Studie: Mehr Gehalt oder mehr Urlaub – was ist Jobsuchenden wichtiger? →
Steuersoftware für Selbstständige: Programme im Kurz-Check
Das Thema Steuern mitsamt der zugehörigen Bürokratie gehört für viele Gewerbetreibende zu den unbeliebtesten Aufgaben des Arbeitslebens. Wer die entsprechenden Kalkulationen nicht selbst durchführen will oder kann, ist in der Regel auf die Hilfe eines Steuerberaters angewiesen. In Form spezieller Steuersoftware für Selbstständige steht aber auch eine praktische Alternative zur Auswahl, mit der sich Kosten-Continue reading Steuersoftware für Selbstständige: Programme im Kurz-Check →