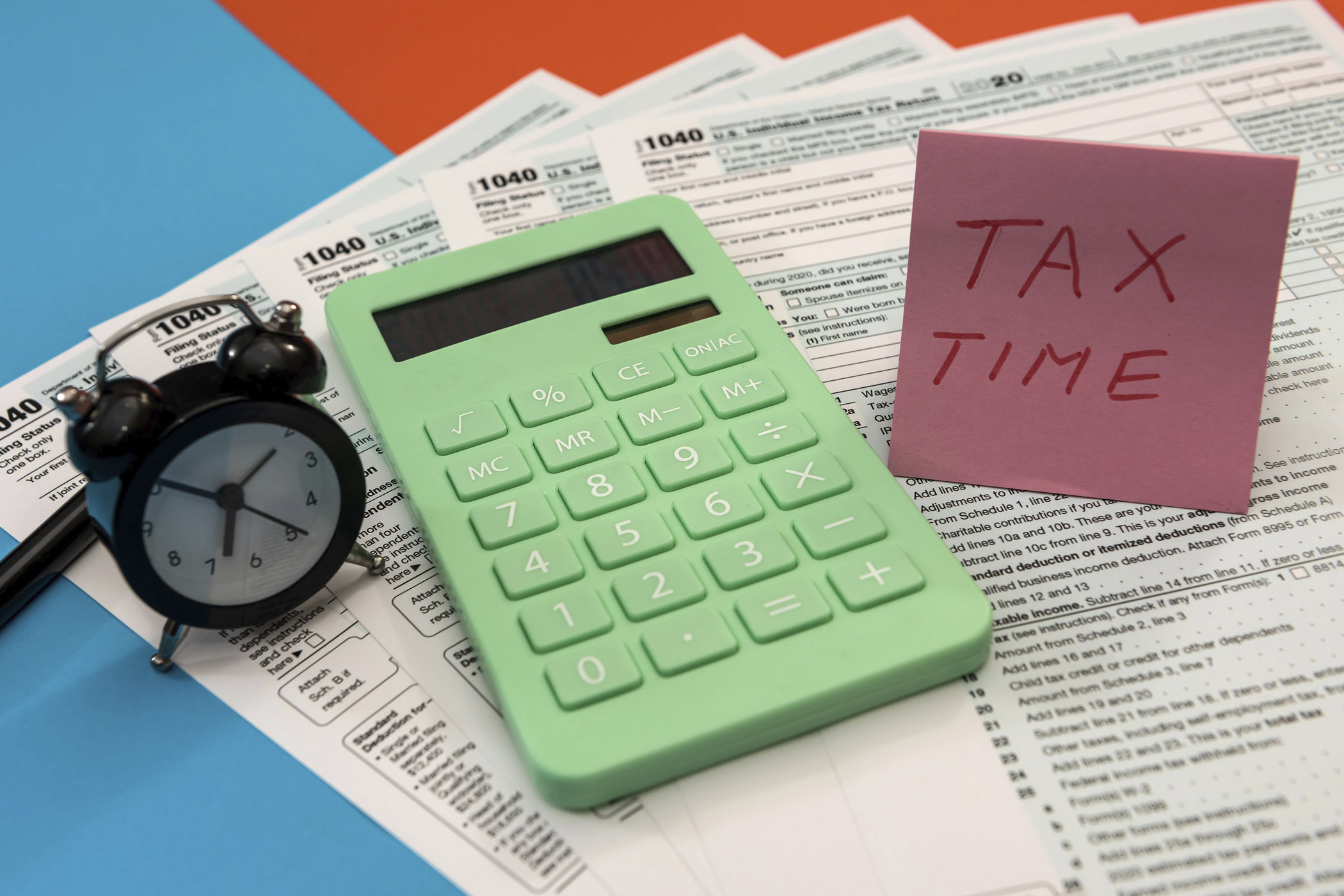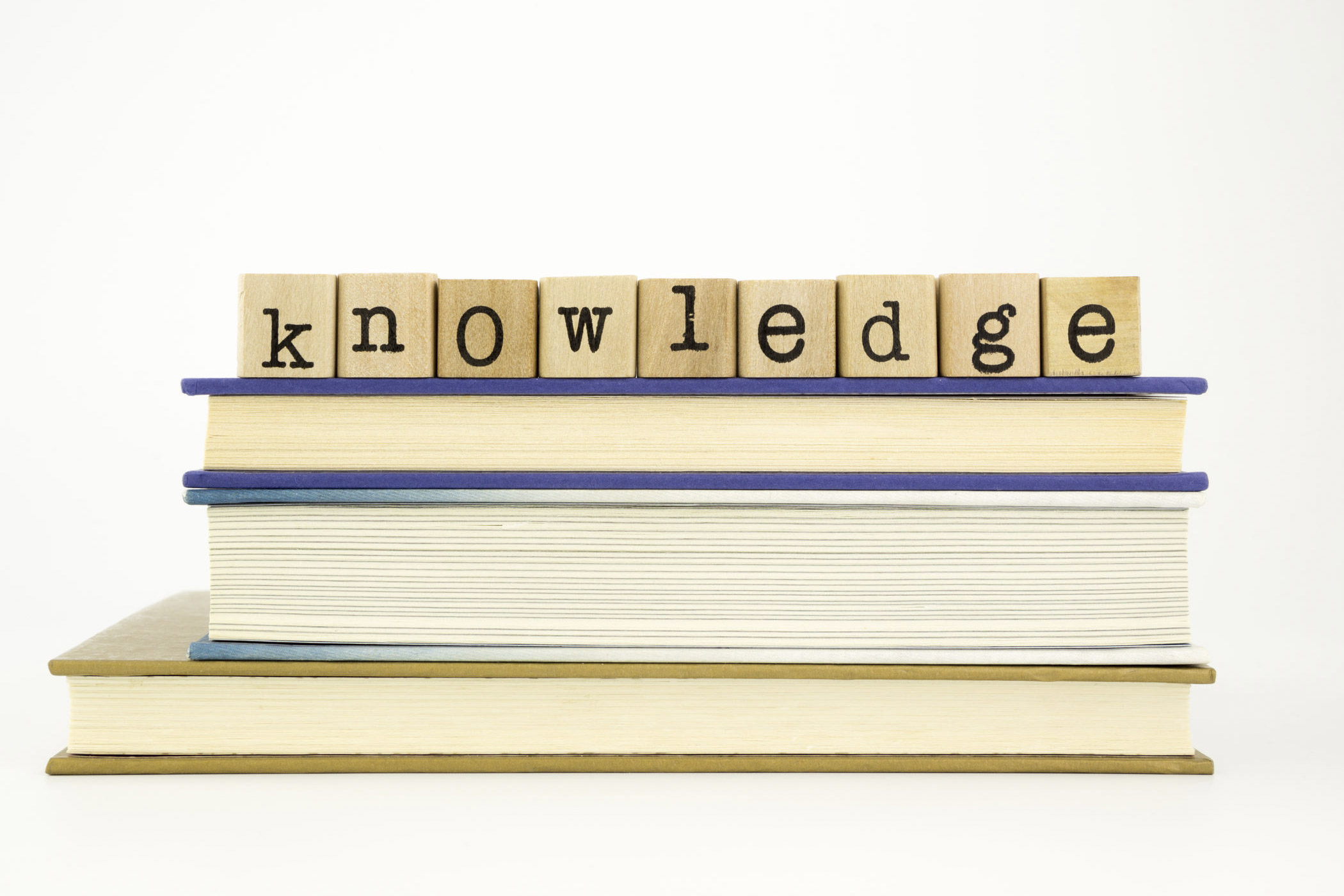Etwa 5,3 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland sind auf Rückenbeschwerden zurückzuführen. Ursache für die Schmerzen sind oft Muskelverspannungen. Massagen helfen, Verspannungen zu lockern und Schmerzen zu lindern. Zudem tragen sie zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Diese positive Wirkung kann man sich auch am Arbeitsplatz zunutze machen. Die Massage im Verlauf der Geschichte Die Massage als HeilkunstContinue reading Die positive Wirkung von Massagen
Steuererklärung 2024: Tipps, um bares Geld zu sparen
An die alljährliche Steuererklärung denken die meisten Arbeitnehmer nur ungern. Und auch wenn sie dabei meistens Geld zurückerhalten, schieben sie die unliebsame Aufgabe gerne vor sich her. Worauf muss ich achten? Was kann ich alles geltend machen und an welchen Stellen ist Vorsicht geboten? Viele praktische Tipps, um Steuern zu sparen, liefert dieser Ratgeber. DieContinue reading Steuererklärung 2024: Tipps, um bares Geld zu sparen →
Erfolgreich im Job mit den 5 Schlüsselkompetenzen
Man nehme eine gute Portion Wissen, füge eine Mischung an erlernten Fähigkeiten hinzu und mische das Ganze mit je einem Schuss persönlicher Einstellung und individuellen Eigenschaften – das Ergebnis sind Schlüsselkompetenzen als wichtiger Türöffner zum beruflichen Erfolg. Unabhängig vom Job und von der Branche sind dabei fünf Schlüsselqualifikationen entscheidend. Was sind Schlüsselkompetenzen? Schlüsselkompetenzen, auch alsContinue reading Erfolgreich im Job mit den 5 Schlüsselkompetenzen →
Revenge Quitting: Warum plötzliche Kündigungen zum Trend werden
Der Montagmorgen beginnt wie jeder andere: Die Kaffeemaschine läuft, der Posteingang quillt über und der Chef verteilt zusätzliche Aufgaben. Plötzlich legt eine Kollegin ihren Firmenausweis auf den Schreibtisch, packt ihre Sachen und verlässt wortlos das Büro. Ohne Erklärung und ohne Einhaltung der Kündigungsfrist ist sie einfach weg: So oder ähnlich sieht Revenge Quitting aus. WasContinue reading Revenge Quitting: Warum plötzliche Kündigungen zum Trend werden →
Effizienz im Büro: In wenig Zeit viel schaffen
Mehr Aufgaben als Zeit? Im Arbeitsalltag ist genau das bei vielen Menschen Realität. Damit die Rechnung dennoch aufgeht und mindestens die wirklich wichtigen Dinge erledigt werden, braucht es mehr als nur Durchhaltevermögen. Mit den richtigen Methoden lässt sich der Tag effizienter gestalten – und das ganz ohne Überstunden oder ständige Hektik. Das sind unsere Tipps.Continue reading Effizienz im Büro: In wenig Zeit viel schaffen →
Büropflanzen-Psychologie: Welche Pflanze passt zu welchem Arbeitsstil?
Büropflanzen sind weit mehr als nur eine Dekoration. Sie bringen etwas Leben in sterile Arbeitsumgebungen, können das Raumklima positiv beeinflussen und sogar die Konzentration und die Kreativität fördern. Doch nicht jede Pflanze passt zu jedem Arbeitsplatz – oder zu jedem Arbeitsstil. Eine gezielte Auswahl macht den Unterschied. Welches Grün ist das richtige? Pflanzen dem ArbeitsstilContinue reading Büropflanzen-Psychologie: Welche Pflanze passt zu welchem Arbeitsstil? →
Büro-Diplomatie: die Kunst, höflich Nein zu sagen
Das Wort Nein ist in der Arbeitswelt oft so unbeliebt wie der letzte Schluck kalter Kaffee im Becher. Dabei sind Absagen auch mal wichtig, um Grenzen zu setzen, Überlastungen zu vermeiden und effizient zu arbeiten. Doch wie sagt man Nein, ohne Kollegen vor den Kopf zu stoßen oder als egoistisch zu gelten? Wir haben Tipps.Continue reading Büro-Diplomatie: die Kunst, höflich Nein zu sagen →
Vom Kollegen zum Chef: Wenn sich im Job plötzlich die Rollen verändern
Eine Beförderung sorgt oft für gemischte Gefühle: Während sich der neue Vorgesetzte über die Karrierechance freut, steht das Team vor einer ungewohnten Situation. Besonders für die Kollegen, die bislang auf Augenhöhe zusammengearbeitet haben, kann der plötzliche Rollenwechsel zur Herausforderung werden. Plötzlich Chef – und alles anders? Eine Beförderung ist zunächst ein Zeichen dafür, dass dieContinue reading Vom Kollegen zum Chef: Wenn sich im Job plötzlich die Rollen verändern →
Wer fliegt zuerst und wer darf bleiben? Die Kriterien der Sozialauswahl
25 Jahre Betriebszugehörigkeit, drei Kinder unter 18 und noch dazu noch ein Alter jenseits der 50 sind perfekte Voraussetzungen, um bei einer betriebsbedingten Kündigung zu den Glücklichen zu gehören, die bleiben dürfen. Eine wichtige Rolle spielt jetzt die Sozialauswahl. Die Ausgangssituation: Wann greift überhaupt eine Sozialauswahl? „Es tut uns sehr leid! Die Inflation und dieContinue reading Wer fliegt zuerst und wer darf bleiben? Die Kriterien der Sozialauswahl →
Büro-Werkzeuge: Diese Helfer sollten immer griffbereit sein
Wer sagt, dass ein Büro nur aus Papier, Stiften und Computern besteht? Manchmal sind es gerade die robusten und vielseitigen Werkzeuge aus Werkstatt und Baumarkt, die überraschende Lösungen für alltägliche Büroprobleme bieten und Ihren Arbeitsplatz unkonventionell produktiver gestalten können. Entdecken Sie hier das umfassende Sortiment an Werkstatt- und Baumarktprodukten von OTTO Office: Die robusten Problemlöser:Continue reading Büro-Werkzeuge: Diese Helfer sollten immer griffbereit sein →
Der gute Ton am Telefon: Tipps für die perfekte Kommunikation am Hörer
Der Griff zum Telefonhörer gehört in vielen Jobs zum beruflichen Alltag. Um Sachverhalte zu klären, Anfragen zu beantworten oder selbst ein Anliegen loszuwerden, bietet ein Telefonat eine schnelle, unkomplizierte und vor allem persönliche Möglichkeit der Kommunikation. Für ein erfolgreiches Gespräch ist es dabei wichtig, einige wichtige Grundregeln zu beachten. Telefon-Knigge: 8 Tipps für erfolgreiche Gespräche
KI-Bewerbungsfotos – (k)eine gute Idee?
Auf dem Foto sitzt der Anzug perfekt, das Lächeln wirkt souverän und der Hintergrund professionell – dabei hat es dieses Motiv nie so gegeben. Dank künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich Bewerbungsfotos heute mit wenigen Klicks generieren. Zwar überzeugen KI-generierte Bilder optisch auf den ersten Blick, sie haben aber auch erhebliche Nachteile. Warum ein echtes BewerbungsfotoContinue reading KI-Bewerbungsfotos – (k)eine gute Idee? →
Privatsphäre im Großraumbüro: Herausforderungen und Tipps
Wie bringe ich meine Idee auf den Punkt? Während man in ein neues Projekt vertieft ist, telefoniert der Kollege am Nebentisch mit seiner Partnerin – nichts Geheimes, aber auch nichts, was man hören wollte. In Großraumbüros verschwimmen die Grenzen zwischen konzentriertem Arbeiten und fehlender Rückzugsmöglichkeit schnell. Doch wo bleibt die Privatsphäre, wenn jede Bewegung sichtbarContinue reading Privatsphäre im Großraumbüro: Herausforderungen und Tipps →
Salz-und-Pfeffer-Test und andere fragwürdige Methoden beim Bewerbungsgespräch
Ein neuer Mitarbeitende, der alle Anforderungen erfüllt und das Team auf Anhieb bereichert, ist der Traum jedes Unternehmens: Doch wie findet man genau diese eine Person, die wie die Faust aufs Auge zum Job passt? Während klassische Bewerbungsgespräche auf Fachwissen, Erfahrung und Persönlichkeit setzen, greifen manche Personalverantwortliche zu kreativeren Methoden. Ob bewusst inszenierte Stresssituationen, psychologischeContinue reading Salz-und-Pfeffer-Test und andere fragwürdige Methoden beim Bewerbungsgespräch →
Powernap: der Kurzschlaf als Leistungsbooster
Im Laufe des Arbeitstages werden die Augenlider schwer, die Konzentration schwindet und selbst das Pling der E-Mail zeigt keine Wirkung mehr. Der Körper sendet uns ein klares Signal: Jetzt ist eine Pause nötig! Doch anstatt sich mit Zucker oder Koffein künstlich wachzuhalten, gibt es eine viel natürlichere Lösung – den Powernap. Ein kurzes Nickerchen kannContinue reading Powernap: der Kurzschlaf als Leistungsbooster →
Batching: Aufgaben bündeln und effektiver arbeiten
Während wir gerade eine E-Mail beantworten, ruft ein Geschäftspartner mit einem dringenden Anliegen an, gleichzeitig steht die Kollegin am Schreibtisch und auch das Smartphone meldet sich mit einem lauten Piepton zu Wort … Wer sich jetzt nicht verzetteln will, sollte es lieber mal mit Batching probieren. Bei der Methode aus dem Zeitmanagement werden Aufgaben sinnvoll gebündeltContinue reading Batching: Aufgaben bündeln und effektiver arbeiten →
Der frühe Vogel … Warum es sich lohnt, möglichst früh in den Arbeitstag zu starten
Während sich die einen lieber noch ein drittes Mal trotz des penetranten Weckerklingelns im Bett umdrehen, sitzen die anderen bereits am Schreibtisch, haben die vierte Mail beantwortet und bereiten sich auf das Meeting vor … Für sie hat der Arbeitstag bereits sehr früh begonnen – und das sogar freiwillig. Der Frühstart hat wesentliche Vorteile, ist aberContinue reading Der frühe Vogel … Warum es sich lohnt, möglichst früh in den Arbeitstag zu starten →
Liebesurlaub im Job: Darf der Partner mit auf die Dienstreise?
Wenn uns der Job nach Paris, London oder gar nach New York führt, kann der Partner schon mal neidisch werden. Dabei muss der oder die Liebste gar nicht unbedingt zu Hause bleiben. Mit der richtigen Planung und Absprache ist es durchaus möglich, die Dienstreise mit dem privaten Urlaub zu verbinden. Welche Regelungen gelten für denContinue reading Liebesurlaub im Job: Darf der Partner mit auf die Dienstreise? →
Die E-Mail-Signatur: Mehr als nur ein Anhängsel
Als obligatorisches Anhängsel schließt eine Signatur jede geschäftliche E-Mail ab. Sie liefert wichtige Informationen über den Absender und erleichtert die weitere Kontaktaufnahme: In der geschäftlichen Korrespondenz ist sie sogar Pflicht. Diese Regeln und Vorgaben gelten für die E-Mail-Signatur. Wer ist zu einer E-Mail-Signatur verpflichtet? Zunächst einmal ist eine E-Mail-Signatur natürlich praktisch: Schließlich lässt sich soContinue reading Die E-Mail-Signatur: Mehr als nur ein Anhängsel →
Tinte vs. Toner: Der Unterschied und so findest du das richtige Zubehör
In Büros wird häufig und viel gedruckt, und die Wahl des richtigen Drucksystems kann einen großen Einfluss auf Effizienz und Kosten haben. Die gängigsten Drucktechnologien sind Tintenstrahldrucker (Tinte) und Laserdrucker (Toner). Doch welche Lösung eignet sich besser für Ihr Büro? In diesem Blogbeitrag beleuchten wir die Vor- und Nachteile von Tinte und Toner, damit SieContinue reading Tinte vs. Toner: Der Unterschied und so findest du das richtige Zubehör →