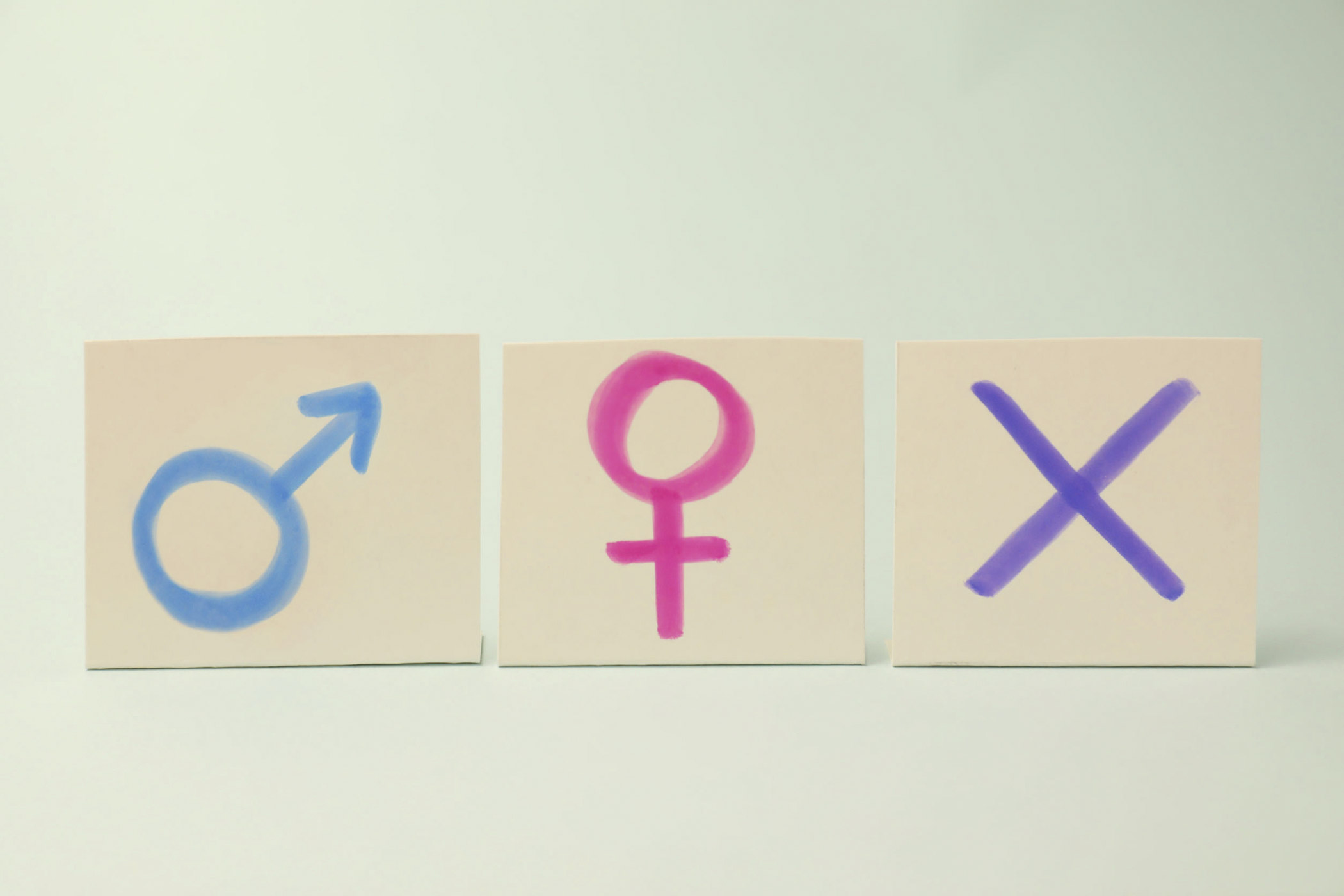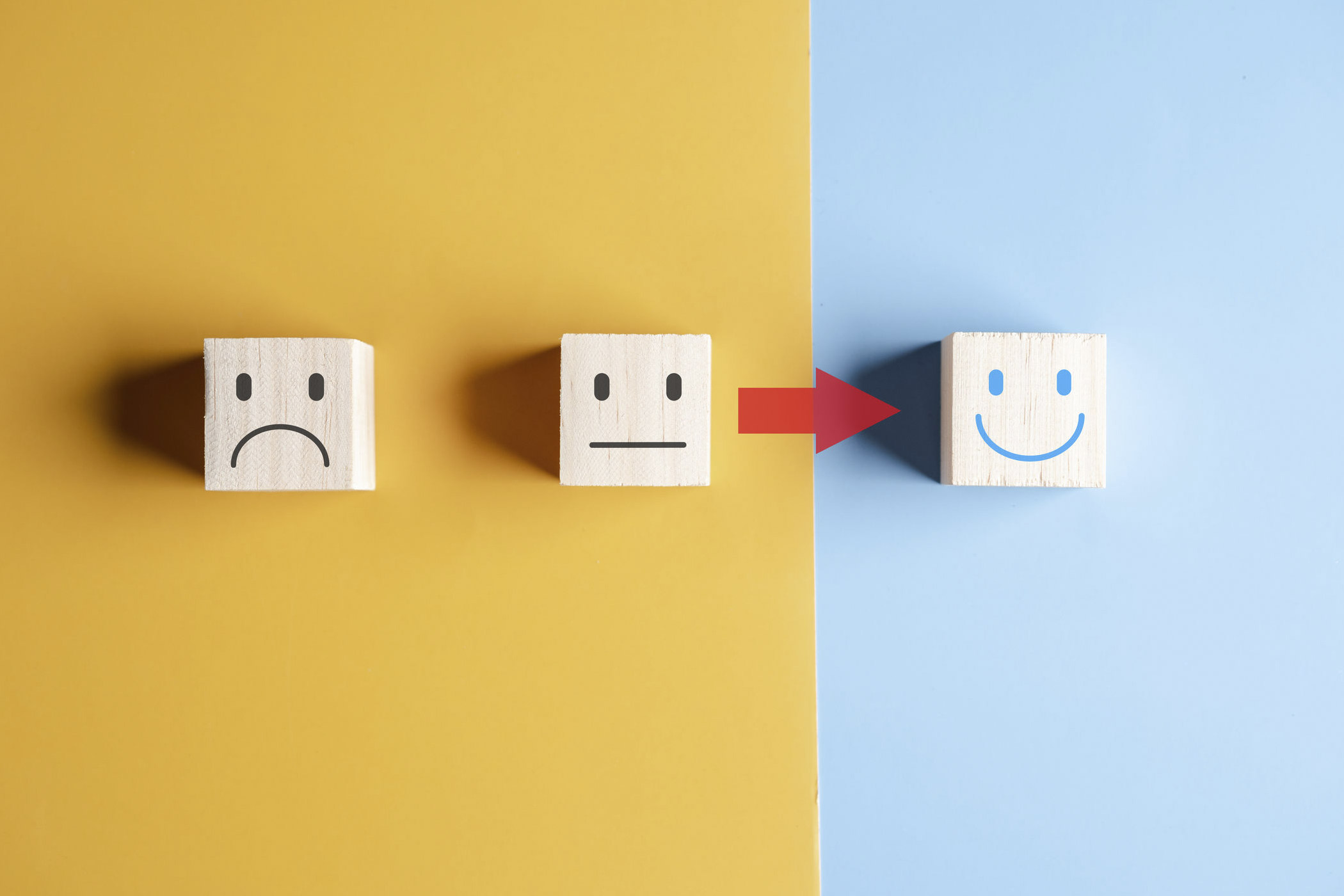Liebesurlaub im Job: Darf der Partner mit auf die Dienstreise?
Wenn uns der Job nach Paris, London oder gar nach New York führt, kann der Partner schon mal neidisch werden. Dabei muss der oder die Liebste gar nicht unbedingt zu Hause bleiben. Mit der richtigen Planung und Absprache ist es durchaus möglich, die Dienstreise mit dem privaten Urlaub zu verbinden.
Welche Regelungen gelten für den Partner bei einer Dienstreise?
Zunächst einmal: Eine klare gesetzliche Definition, was genau eine Dienstreise ist, gibt es in Deutschland nicht. Dementsprechend schreibt auch keine allgemeine Regelung vor, dass eine betriebliche Reise für den Arbeitgeber nur allein beziehungsweise allenfalls mit Kollegen stattfinden darf. Bedeutet: Grundsätzlich ist es daher möglich und „erlaubt“, den Partner mitzunehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass sämtliche Kosten des Partners privat getragen werden.
Damit das funktioniert und es am Ende nicht zu Unstimmigkeiten und Ärger mit dem Arbeitgeber kommt, gelten klare Regeln für die Kostentrennung wie folgt:
- die Übernachtung: Die Hotelrechnung weist explizit die Kosten für ein Einzelzimmer und ausschließlich für den Mitarbeitenden aus. In einer zweiten (für die private Ablage gedachte) Abrechnung ist dann der Differenzbetrag zwischen Einzel- und Doppelzimmer aufgeführt. In aller Regel nimmt dieser Betrag nur einen geringen Anteil an der Gesamtrechnung ein.
- die Verpflegung: Wird im Restaurant gegessen, so funktioniert das nur mit zwei getrennten Rechnungen, um Missverständnisse zu vermeiden.
- die Anfahrt: Wer mit dem Auto anreist, kann die komplette Kilometerpauschale beziehungsweise die Spritkosten in voller Höhe beim Arbeitgeber einreichen. Kostenmäßig macht es schließlich keinen Unterschied, ob man allein oder zu zweit fährt. Gleiches gilt für Fahrten mit dem Taxi. Anders sieht es dagegen bei Zugfahrten und Flügen aus: Hier hat jede Person ihr eigenes Ticket.
- weitere Zahlungen: Für alle weiteren Zahlungen gilt natürlich auch die getrennte Kasse. Wer eine Firmenkreditkarte nutzt, achtet penibel genau darauf, dass die Kosten des Partners nicht damit abgerechnet werden. Ausnahmen gelten immer dann, wenn die andere Person zwar von einer Aktivität profitiert, sie jedoch selbst keine eigenen Kosten verursacht.
Tipp: Auch wenn es nicht zwingend erforderlich ist, setzen Sie Ihren Chef am besten davon in Kenntnis, dass Sie nicht alleine reisen. Denn sollte er es im Nachhinein erfahren, könnte dies schnell ein Geschmäckle hinterlassen – auch wenn es eigentlich gar nichts zu verheimlichen gibt. Darüber hinaus besteht bei einer offenen Kommunikation sogar die Chance, dass sich das Unternehmen großzügig zeigt und alle Kosten trägt.
Kombi aus Privat- und Dienstreise: Wann zahlt der Arbeitgeber?
Je nach Attraktivität des Reiseziels für den Job nutzen Angestellte gerne die Chance, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden und die Dienstreise gemeinsam mit dem Partner für den privaten Urlaub zu verbinden. Hier gilt: Werden höchstens fünf freie Tage hintendran gehängt oder vorher genommen, dann bleibt es bei der „Dienstreise“ und der Arbeitgeber trägt die Fahrtkosten für die Hin- und Rückreise, auch wenn sie zeitlich etwas versetzt zum eigentlichen beruflich bedingten Aufenthalt liegen.
Anders sieht es aus, wenn der private Urlaub länger als fünf Tage dauert oder wenn der berufliche Anteil an der Reise weniger als zehn Prozent beträgt: In diesen Fällen handelt es sich um eine „Urlaubsreise“, die der Angestellte natürlich selbst zahlen muss. Der Arbeitgeber steht jetzt lediglich in der Pflicht, den Mehraufwand für den beruflichen Anteil zu übernehmen.
Urheber des Titelbildes: nutthasethv/ 123RF Standard-Bild