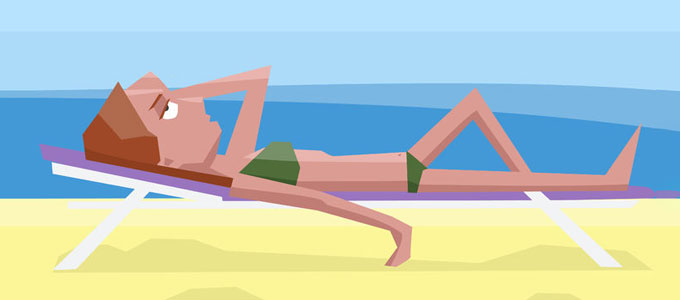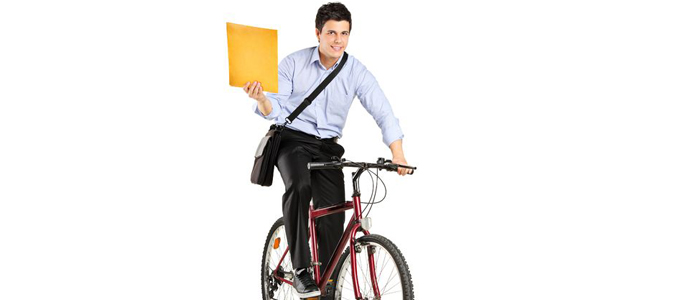Die Stimmung im Büro verbessern? Nun ja, Bürogemeinschaften sind Zwangsgemeinschaften. Deutsche Angestellte verbringen in der Regel mehr Zeit mit ihren Kollegen als mit ihrer Familie. Und wenn in den langen Stunden des Zusammensitzens der Bürofrieden schief hängt, zieht sich die Zeit unangenehm lange hin. Stimmung im Büro verbessern – welche Faktoren sind entscheidend? Das StatistikportalContinue reading Studie: Stimmung im Büro verbessern – oft helfen Kleinigkeiten
Steigert Musik die Konzentration beim Arbeiten?
Ob Musik für die Konzentration beim Arbeiten förderlich ist, war schon mehrfach Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Die Experten merken allerdings an, die richtige Auswahl sei maßgeblich. Denn je nachdem, wie eine Arbeit beschaffen ist, lassen sich ihr bestimmte Stilrichtungen zuweisen, deren Musik die Konzentration beim Arbeiten tatsächlich verbessert. Musik steigert Konzentration beim Arbeiten – findenContinue reading Steigert Musik die Konzentration beim Arbeiten? →
Wissenswertes zum Thema Firmenwagen
Ein Firmenwagen ist sowohl ein Statussymbol als auch eine besondere Wertschätzung durch den Arbeitgeber, lohnt sich allerdings nicht für alle Personen gleichermaßen. Denn wer den Dienstwagen auch für private Fahrten nutzen darf bzw. möchte, muss diesen als geldwerten Vorteil versteuern. Es gilt daher, sich sehr gut zu überlegen und auszurechnen, ob sich ein Dienstwagen durchContinue reading Wissenswertes zum Thema Firmenwagen →
Arbeit ohne Gähnen: Was vertreibt hartnäckige Büro-Müdigkeit?
Büroangestellte kämpfen nicht nur mit ihrer Arbeit, sondern auch mit der Büro-Müdigkeit. Das ist ganz normal bei einer Tätigkeit, die in geschlossenen Räumen und fast ausschließlich im Sitzen stattfindet. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich die Schläfrigkeit aber vertreiben – und weiteren Gähn-Attacken vorbeugen. Tipp 1 gegen Büro-Müdigkeit: Auf die Beine, Fenster öffnen EinContinue reading Arbeit ohne Gähnen: Was vertreibt hartnäckige Büro-Müdigkeit? →
Die beliebtesten Snacks gegen den Heißhunger
Obwohl das Frühstück oder das Mittagessen noch nicht lange her ist, müssen Sie unbedingt eine Kleinigkeit essen. Die Hauptursache dafür ist ein niedriger Blutzuckerspiegel. Denn wenn der Zuckergehalt im Blut sinkt, fängt der Magen an zu knurren – häufig sogar unüberhörbar. Auch Hormone wie Serotonin und Kortison beeinflussen unseren Appetit, der sich manchmal kaum zügelnContinue reading Die beliebtesten Snacks gegen den Heißhunger →
Das ist mir jetzt aber peinlich … Der richtige Umgang mit Blamagen im Büroalltag
Das Leben ist gepflastert mit Fettnäpfchen. Überall lauert die Gefahr, sich bis auf die Knochen zu blamieren. Das gilt insbesondere für das Büro. Dort, wo die meisten Menschen selbstbewusst erscheinen möchten, wiegt die vermeintliche Blamage oft schwerer als im Privatleben. In vielen Köpfen gelten Peinlichkeiten als Zeichen der Schwäche. Sensible Angestellte fühlen sich bloßgestellt, ihrContinue reading Das ist mir jetzt aber peinlich … Der richtige Umgang mit Blamagen im Büroalltag →
Mit dem E-Bike pendeln: Wie fit macht ein Elektrorad?
Mit dem E-Bike zu pendeln spart Geld und Zeit. Und es schont die Umwelt. Aber hält ein E-Bike auch fit? Klare Antwort: Trotz elektrischer Motorisierung sind die Fahrer sportlich unterwegs, Studien haben den Trainingseffekt der Elektroräder belegt. Per E-Bike pendeln – auch auf längeren Strecken? Jeder sechste Arbeitnehmer fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit,Continue reading Mit dem E-Bike pendeln: Wie fit macht ein Elektrorad? →
Sind Sie ein Workaholic?
Die Bezeichnung Workaholic wird im täglichen Sprachgebrauch häufig verwendet. Vielen ist dabei gar nicht klar, dass ein Workaholic nicht nur jemand ist, der überdurchschnittlich viel arbeitet, sondern regelrecht süchtig nach Arbeit ist. Nicht von ungefähr leitet sich das Wort aus den englischen Begriffen work und alcoholism ab. Während der Alkoholiker zwanghaft Alkohol trinken muss, versuchtContinue reading Sind Sie ein Workaholic? →
Hilfe, mein Kollege ist ein Faulpelz!
In fast jedem Team gibt es sie. Kollegen, die es sich im Büro bequem machen und nur so tun als ob sie arbeiten würden, wenn der Vorgesetzte in der Nähe ist. Die WhatsApp-Nachrichten schreiben anstatt die Geschäftsmails zu lesen. Die mit Freunden telefonieren anstatt den Kunden zurückzurufen. Die im Internet surfen anstatt sich auf dasContinue reading Hilfe, mein Kollege ist ein Faulpelz! →
E-Mail-Missverständnisse können das Büroklima vergiften
E-Mail-Missverständnisse lauern auf Schritt und Tritt. Wer mit der deutschen Sprache nicht auf dem Kriegsfuß steht, hat eine Mail zwar schnell formuliert und abgeschickt. Aber Vorsicht: Viele Botschaften kommen beim Empfänger nicht so an, wie der Absender sie gemeint hat. Erst denken, dann schreiben – und so E-Mail-Missverständnisse verhindern Es gibt einen Grundsatz höflicher Kommunikation:Continue reading E-Mail-Missverständnisse können das Büroklima vergiften →
Schon wieder krank im Urlaub?
Wenn Sie ausgerechnet an Wochenenden oder bei Urlaubsbeginn krank werden, könnten Sie zu der Personengruppe gehören, die unter „Leisure Sickness“ (Freizeitkrankheit) leiden. Laut einer aktuellen Studie im Auftrag der IUBH (Internationale Hochschule Bad Honnef – Bonn) hat fast jeder fünfte Deutsche mit diesem Phänomen zu kämpfen. Das versteht man unter Leisure Sickness Endlich istContinue reading Schon wieder krank im Urlaub? →
Warum lohnt sich Dienstfahrrad-Leasing für Sie und Ihren Chef?
Ein Dienstwagen ist eine feine Sache. Aber nicht jeder bekommt ihn, und wer ihn hat, steht damit oft im Stau. Eine gesunde und mitarbeiterfreundliche Alternative ist das Dienstfahrrad-Leasing. Von seinen Vorteilen profitieren Arbeitnehmer und Arbeitgeber zugleich. Der Mitarbeiter kommt auf günstige Weise an ein hochwertiges Fahrrad. Und der Arbeitgeber kann die Ausgaben als Betriebskosten absetzen.Continue reading Warum lohnt sich Dienstfahrrad-Leasing für Sie und Ihren Chef? →
Viele Gründe, warum Kaffee nicht ungesund ist
Was wäre ein deutsches Büro ohne Kaffee? Eine Ansammlung missgestimmter, leistungsschwacher Angestellter. Aber in den letzten Jahren haben sich viele Kollegen mit wachsend schlechtem Gesundheits-Gewissen zur Kaffeemaschine geschlichen. Die neuesten medizinischen Erkenntnisse lassen Kaffeeliebhaber wieder aufatmen: Kaffeekonsum ist nicht ungesund. Im Gegenteil: Kaffee fördert die Gesundheit! Kaffee macht schlau Dass Kaffee schlau macht, mussContinue reading Viele Gründe, warum Kaffee nicht ungesund ist →
Shorts verboten: Warum sind kurze Hosen im Job verpönt?
Die meisten Menschen möchten lieber im Büro als auf der Baustelle arbeiten. Außer an heißen Sommertagen. Denn die Kleiderordnung in den meisten Büros ist streng. Es gilt: Shorts verboten. Der Ernst der Arbeit soll sich in einer angemessenen Kleidung widerspiegeln. Dagegen hilft nur ein Antrag auf Home Office. Shorts verboten, da kam der AngestellteContinue reading Shorts verboten: Warum sind kurze Hosen im Job verpönt? →
Buchtipps für den Arbeitsweg mit Bus und Bahn
Häufig begleiten Gedanken zu anstehenden Aufgaben bereits den Weg zur Arbeit in Bus und Bahn. Frustrierend werden diese, wenn es um eigene gute Ideen geht, die bei den entscheidenden Leuten keinen Anklang finden. Wie lassen sich hier die geistigen Blockaden lösen? Genau damit beschäftigt sich das Buch von Marco von Münchhausen und Cay von FournierContinue reading Buchtipps für den Arbeitsweg mit Bus und Bahn →
Büro-Frust überwinden: 5 Tipps, um wieder mit Spaß zu arbeiten
Büro-Frust wirkt auf Stimmung und Produktivität so lähmend wie ein chronischer Infekt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Frust und Infekt: Der Infekt ist mit Medikamenten schnell in den Griff zu bekommen – der Frust ist schwieriger zu bekämpfen und verstärkt sich, je länger er dauert. Dennoch gibt es Wege aus dem Zufriedenheitstief. Wie soContinue reading Büro-Frust überwinden: 5 Tipps, um wieder mit Spaß zu arbeiten →
Dresscode: Der moderne Business-Look für Herren
Zwar sollte man das Buch nicht nach seinem Deckel beurteilen, dennoch ist der erste Eindruck sehr wichtig. Das gilt natürlich auch – oder besonders – für das Berufsleben. Innerhalb von Millisekunden wird eine Person eingeschätzt und in Schubladen einsortiert: sympathisch / unsympathisch, freundlich / unfreundlich, kompetent / inkompetent, attraktiv / nicht attraktiv oder vertrauenswürdig /Continue reading Dresscode: Der moderne Business-Look für Herren →
Netto-Gehalt steuerfrei aufstocken – mit Aufmerksamkeiten und Sachbezügen
Das Netto-Gehalt steuerfrei aufzustocken bringt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen Vorteile. Die Zuschüsse sind steuer- und sozialversicherungsfrei, möglich ist die Zuwendung in Form von sogenannten Aufmerksamkeiten und Sachbezügen. Für beide Arten der steuerfreien Aufstockung des Netto-Gehalts gibt es feste gesetzliche Regeln und Grenzen. Steuerfreie Aufmerksamkeiten zu besonderen Anlässen Wenn der Arbeitgeber das Netto-Gehalt steuerfreiContinue reading Netto-Gehalt steuerfrei aufstocken – mit Aufmerksamkeiten und Sachbezügen →
Hörbuchtipps für den Arbeitsweg
In Deutschland gibt es laut Audible Hörkompass 2016 fast 11 Millionen Menschen, die sich regelmäßig ein Hörbuch anhören, d.h. mindestens einmal im Monat. Die Studie erklärt den Erfolg des Hörbuches mit der „Wiedergeburt des Geschichtenerzählens“. Für viele ist das Hörbuch ein ständiger Begleiter, auch auf dem Weg zur Arbeit bzw. auf Geschäftsreisen. Im Auto, inContinue reading Hörbuchtipps für den Arbeitsweg →
Büro-Wissen (Teil 3): Frieren Frauen schneller am Arbeitsplatz?
Zwischen Frauen und Männern gibt es im Büro einen klassischen Streitfall: die Höhe der Raumtemperatur. Frauen beklagen sich meist über zu kalte Räume, Männer über zu warme. Viele Männer sind der Meinung, ihre Kolleginnen seien schlichtweg zimperlich. Tatsächlich hat das unterschiedliche Temperaturempfinden jedoch physiologische Gründe. Wie eine niederländische Studie untermauert, frieren Frauen schneller als Männer.Continue reading Büro-Wissen (Teil 3): Frieren Frauen schneller am Arbeitsplatz? →