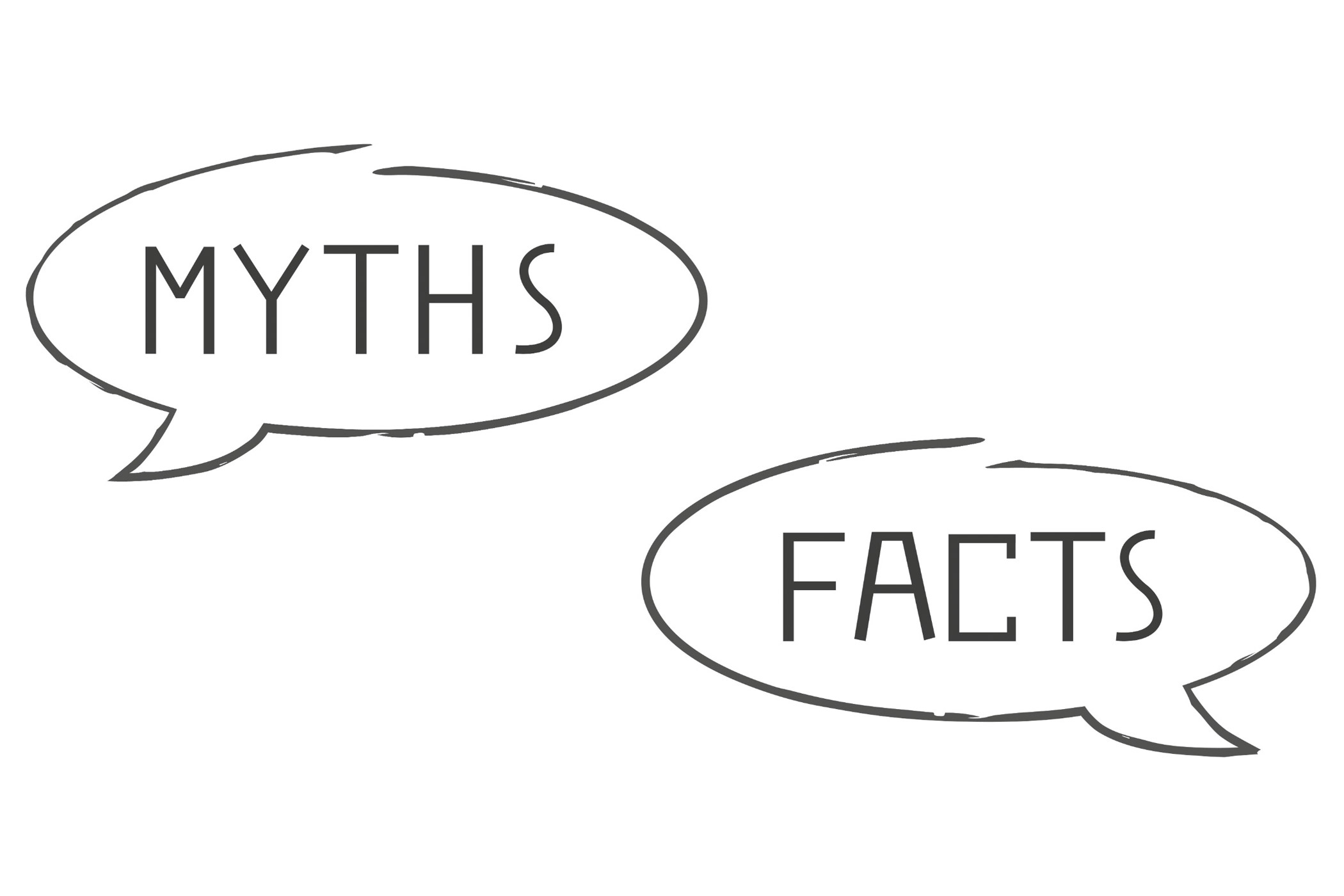Ob zum Ablesen des Stroms, zur Heizungswartung oder auch für dringende Reparaturen, es kommt immer mal wieder vor, dass Handwerker die Wohnung betreten müssen. Was aber ist, wenn der Termin mit der eigenen Arbeitszeit kollidiert? Haben Arbeitnehmende jetzt Anspruch auf Sonderurlaub, vielleicht sogar bezahlten? Die Ausgangslage: Der Handwerker meldet sich an Mieter, aber auch EigentümerContinue reading Handwerker-Termin: Was Arbeitnehmer jetzt wissen sollten
Time Blocking – die eigene Zeit effektiv managen
Wer tagtäglich von Meeting zu Meeting hetzt, an verschiedenen Projekten arbeitet und zwischendurch auch noch E-Mails beantwortet und Telefonate erledigt, verliert irgendwann den Überblick. Um die eigene Zeit effektiv zu strukturieren und zu nutzen, kann Time Blocking eine gute Möglichkeit sein. Bei dieser Form des Zeitmanagements wird die verfügbare Zeit bewusst in Blöcke eingeteilt. WasContinue reading Time Blocking – die eigene Zeit effektiv managen →
Unbegrenzter Urlaub: Wenn Mitarbeiter so viel Freizeit haben, wie sie möchten
Fast klingt es zu schön, um wahr zu sein: Denn welcher Angestellte würde sich nicht darüber freuen, so viele freie Tage im Jahr zu haben wie er möchte und dafür auch noch bezahlt zu werden? Unbegrenzter Urlaub ist längst kein unerfüllter Traum mehr – und dennoch hat dieser Trend in der Arbeitswelt auch Schattenseiten. WasContinue reading Unbegrenzter Urlaub: Wenn Mitarbeiter so viel Freizeit haben, wie sie möchten →
Geheimnisse am Arbeitsplatz: Was Mitarbeiter verschweigen dürfen und was nicht
Für den Erfolg spielt eine offene Kommunikation eine zunehmend wichtige Rolle in Unternehmen. Eine gute Gesprächskultur hat aber auch ihre Grenzen. Vor allem wenn es in den privaten Bereich geht, haben Mitarbeitende auch das Recht zu schweigen. Aber welche Geheimnisse sind eigentlich erlaubt und welche nicht? Eine Erkrankung Natürlich versteht es sich von selbst, dassContinue reading Geheimnisse am Arbeitsplatz: Was Mitarbeiter verschweigen dürfen und was nicht →
Quiet Firing – wenn Mitarbeiter still und heimlich vergrault werden
Die feine, englische Art ist definitiv etwas anderes: Auf subtile Art und Weise verleiden Arbeitgeber einem Mitarbeiter den Job so sehr, dass dieser irgendwann von alleine kündigt. Das bekannte Phänomen hat einen neuen Namen: Quiet Firing Der stille Rauswurf – was steckt hinter dem Trendbegriff? Mit „Quiet Firing“ macht ein neuer Begriff vor allem inContinue reading Quiet Firing – wenn Mitarbeiter still und heimlich vergrault werden →
Schulpflichtige Kinder: Haben berufstätige Eltern ein Recht auf Urlaub in den Ferien?
Für zwei Wochen im Februar in die Sonne fliegen? Einen Kurzurlaub im September planen? Für Eltern ist die freie Urlaubswahl zumindest terminlich unmöglich. Spätestens dann, wenn die Kinder in die Schule kommen, sind sie auf die Schulferien angewiesen. Aber haben sie als Angestellte auch ein Recht darauf, während dieser zwölf Wochen des Jahres ihre UrlaubstageContinue reading Schulpflichtige Kinder: Haben berufstätige Eltern ein Recht auf Urlaub in den Ferien? →
Geduld lernen – warum diese Tugend im Job so wichtig ist
Die Situation kennen viele: Das Wartezimmer beim Arzt ist proppenvoll, man ist zu stundenlangem untätigen Warten verdammt, obwohl man selbst noch wichtige berufliche Termine wahrnehmen muss. Die Fähigkeit, das Warten jetzt auch emotional zu ertragen, heißt Geduld. Diese Eigenschaft besitzt nicht jeder, sie kann aber trainiert werden – und nebenbei sogar die Karriere beflügeln. NichtContinue reading Geduld lernen – warum diese Tugend im Job so wichtig ist →
5 einfache Ideen für wirklich erfolgreiches Recruiting
Der Fachkräftemangel stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Wer qualifiziertes Personal finden möchte, kann sich nicht mehr allein auf den althergebrachten Recruiting-Prozess per Stellenanzeigen verlassen. Neue Ideen sind gefragt. Erfolgversprechende Recruiting-Strategien müssen nicht immer kompliziert und teuer sein. Hier stellen wir Ihnen fünf einfache Lösungen vor, die Sie mit geringem Aufwand umsetzen können. Der Recruiting-ProzessContinue reading 5 einfache Ideen für wirklich erfolgreiches Recruiting →
Direktionsrecht: Was darf der Chef anordnen und was nicht?
Dass der Arbeitsbeginn bereits um 7 Uhr morgens ist, der Mitarbeiter auch mal Kopierarbeiten erledigt oder einen bestimmten Dresscode beachtet, sind typische Regelungen, die unter das Direktionsrecht fallen. Was der Chef seinen Angestellten vorschreiben darf und wo seine Grenzen sind, erklärt dieser Ratgeber. Was besagt das Direktionsrecht? Chef bestimmt, Mitarbeiter führt aus – vereinfacht gesagtContinue reading Direktionsrecht: Was darf der Chef anordnen und was nicht? →
Beim alten Chef nachfragen – sind Erkundigungen bei Bewerbungen erlaubt?
Trotz der einwandfreien Bewerbungsunterlagen und eines positiven Eindrucks beim Vorstellungsgespräch ist der Personaler nicht komplett überzeugt. Ist der Bewerber tatsächlich so gut, wie er sich verkauft und stimmen seine Angaben wirklich? Zur Sicherheit fragt er lieber nochmal beim aktuellen Arbeitgeber nach. Aber sind solche Erkundigungen überhaupt erlaubt und was haben sie für Konsequenzen für dieContinue reading Beim alten Chef nachfragen – sind Erkundigungen bei Bewerbungen erlaubt? →
Ferienjobs – Infos für Jugendliche, Eltern und Unternehmen
In der Sonne liegen oder doch lieber das Taschengeld aufbessern? Vor dieser Frage stehen Jugendliche in den Ferien. Mit einem Ferienjob können junge Menschen schon früh ihre beruflichen Neigungen austesten und ihr erstes eigenes Geld verdienen. Das fördert Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Was es für Unternehmen, Jugendliche und Eltern vor der Aufnahme eines Ferienjobs zu beachtenContinue reading Ferienjobs – Infos für Jugendliche, Eltern und Unternehmen →
Scary-Hour-Trick: So werden unliebsame Aufgaben schneller erledigt
Die lästige Ablage, die Korrespondenz mit einem schwierigen Kunden oder die eintönige Tabellenkalkulation für die Bilanz – im beruflichen und privaten Alltag gibt es immer mal wieder Aufgaben, die so unbeliebt sind, dass wir sie in schönster Regelmäßigkeit gerne vor uns herschieben. Damit sich der Berg an Arbeit aber nicht irgendwann so hoch auftürmt, dassContinue reading Scary-Hour-Trick: So werden unliebsame Aufgaben schneller erledigt →
Das Parkinsonsche Gesetz – wenn die Zeit die Arbeitsdauer vorgibt
Wer eine Stunde Zeit für eine Aufgabe hat, der benötigt in der Regel auch genau diese Zeit – mit dieser kurzen Beschreibung lässt sich das Phänomen beziehungsweise das Problem des Parkinsonschen Gesetzes auf den Punkt bringen. Die Lösung: Für ein effektiveres Zeitmanagement sollte man nicht bis zur letzten Minute warten. Keine neue Erkenntnis und dochContinue reading Das Parkinsonsche Gesetz – wenn die Zeit die Arbeitsdauer vorgibt →
Prozessfinanzierung im Arbeitsrecht
Das deutsche Arbeitsrecht schützt Arbeitnehmer unter anderem vor ungerechtfertigter Kündigung, vor Diskriminierung am Arbeitsplatz und vor Überlastung durch zu lange Arbeitszeiten. Im Streitfall kann es um sehr viel Geld gehen. So mancher Arbeitnehmer zögert allerdings, das eigene Recht durchzusetzen. Viele fürchten, dass der Arbeitnehmer am längeren Hebel sitzt und sich mithilfe von Staranwälten und gutenContinue reading Prozessfinanzierung im Arbeitsrecht →
Singletasking: Darum sollte man sich nur auf eine Sache konzentrieren
Telefonieren und nebenbei eine E-Mail lesen, vielleicht sogar noch den Schreibtisch aufräumen? Menschen, die mehr als eine Aufgabe gleichzeitig erledigen können, gelten als multitaskingfähig. Warum dieser lange gehypte Soft Skill im Berufsleben aber eigentlich gar nicht so erstrebenswert ist und Singletasking die deutlich effektivere Arbeitsweise sein kann, erklärt dieser Ratgeber. Multitasking versus Singletasking: Das sindContinue reading Singletasking: Darum sollte man sich nur auf eine Sache konzentrieren →
Migräne am Arbeitsplatz
Betroffene wissen es: Eine Migräne ist viel mehr als ein gewöhnlicher Kopfschmerz. Sie zeichnet sich durch heftige, meist einseitige Schmerzen aus, in manchen Fällen begleitet von Sehstörungen, Übelkeit und Erbrechen. An Arbeit ist zunächst nicht mehr zu denken. Wie gehen Sie also mit Migräne am Arbeitsplatz am besten um? Hier gibt es Tipps. Migräne: WasContinue reading Migräne am Arbeitsplatz →
Quiet Hiring – neuer Begriff, bewährte Praxis
Nach Quiet Quitting ist Quiet Hiring der neue Trend in der Arbeitswelt. Und auch wenn der Begriff bislang eher unbekannt war, ist die Praxis, die sich hinter der Wortschöpfung verbirgt, keine neue: Beim Quiet Hiring erhalten Angestellte neue Aufgaben. Was verbirgt sich hinter dem Arbeitsmarkttrend? Wörtlich übersetzen lässt sich der Begriff mit „stilles Einstellen“. ImContinue reading Quiet Hiring – neuer Begriff, bewährte Praxis →
Job-Mythen: die größten Irrtümer rund um das Arbeitsrecht
Für Arbeit am Sonntag erhalte ich mehr Geld und in der Probezeit darf ich keinen Urlaub nehmen. Stimmt das wirklich? Auch wenn uns einige Regelungen logisch erscheinen, bedeutet das nicht, dass sie auch stimmen. Vor allem bei arbeitsrechtlichen Fragen vertrauen viele Angestellte auf ihr juristisches Halbwissen und liegen schnell daneben. In diesem Artikel räumen wirContinue reading Job-Mythen: die größten Irrtümer rund um das Arbeitsrecht →
Sich neben dem Job engagieren: die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf
Nach Feierabend die Fußballmannschaft trainieren, als Helfer die Feuerwehr unterstützen oder Spenden für Obdachlose sammeln – es gibt viele Möglichkeiten, sich freiwillig zu engagieren. Auch wenn der Balanceakt manchmal groß ist, können natürlich auch Berufstätige ein Ehrenamt ausüben. Dieser Ratgeber erläutert, was es dabei alles zu beachten gibt. Voll berufstätig: Welches Ehrenamt kann ich nebenbeiContinue reading Sich neben dem Job engagieren: die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf →
Resturlaub: Arbeitnehmende können sich über neue Regelung freuen
Meist ist es ein besonders hohes Arbeitsaufkommen, das Angestellte daran hindert, ihren Urlaub komplett bis zum Ende des Jahres genommen zu haben. Dank einer Gesetzesänderung müssen sie nun aber nicht mehr befürchten, dass ihnen die freien Tage ersatzlos gestrichen werden. Denn: Resturlaub verfällt jetzt nicht mehr automatisch. Die Ausgangslage: Das galt bisher Die Regelung imContinue reading Resturlaub: Arbeitnehmende können sich über neue Regelung freuen →