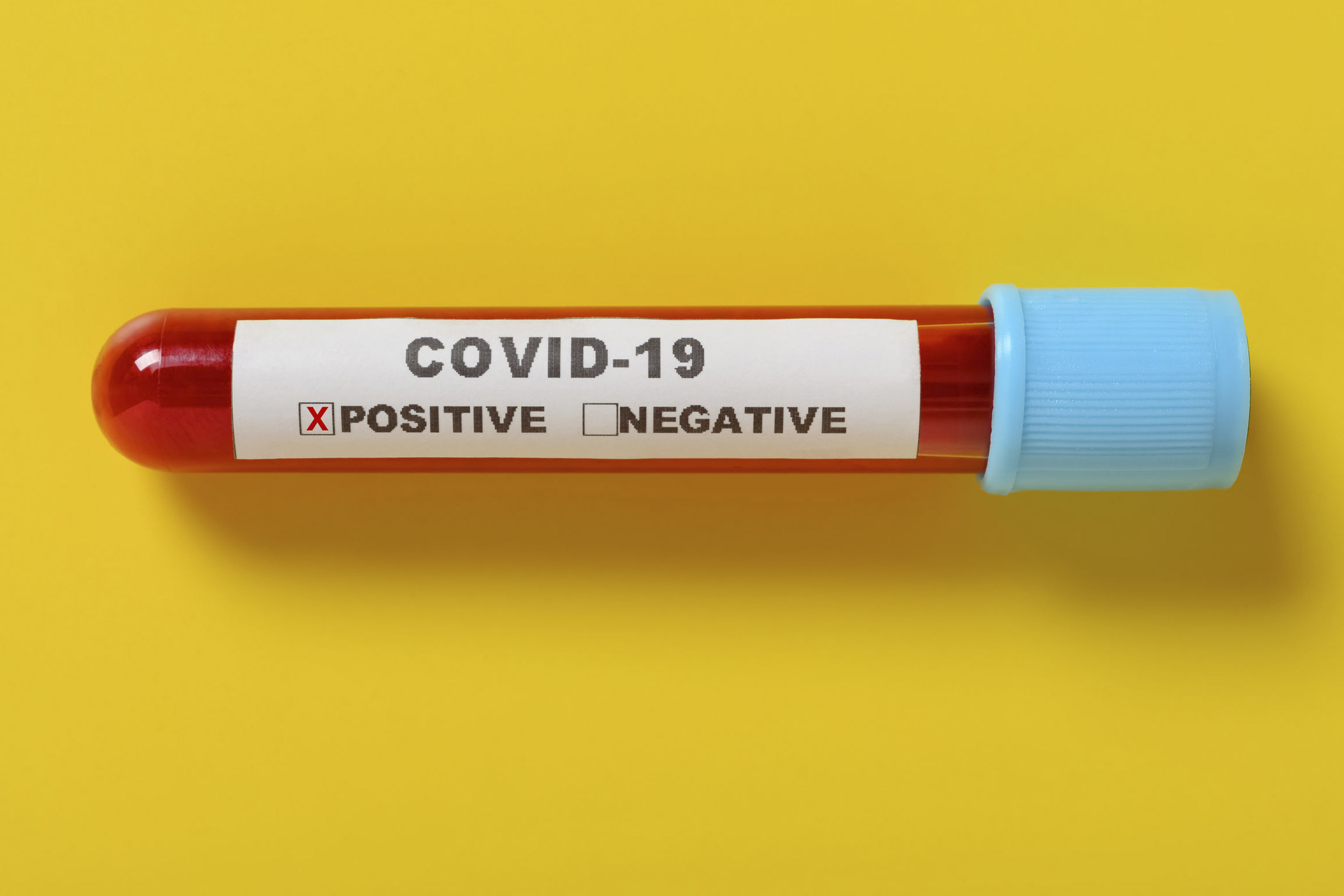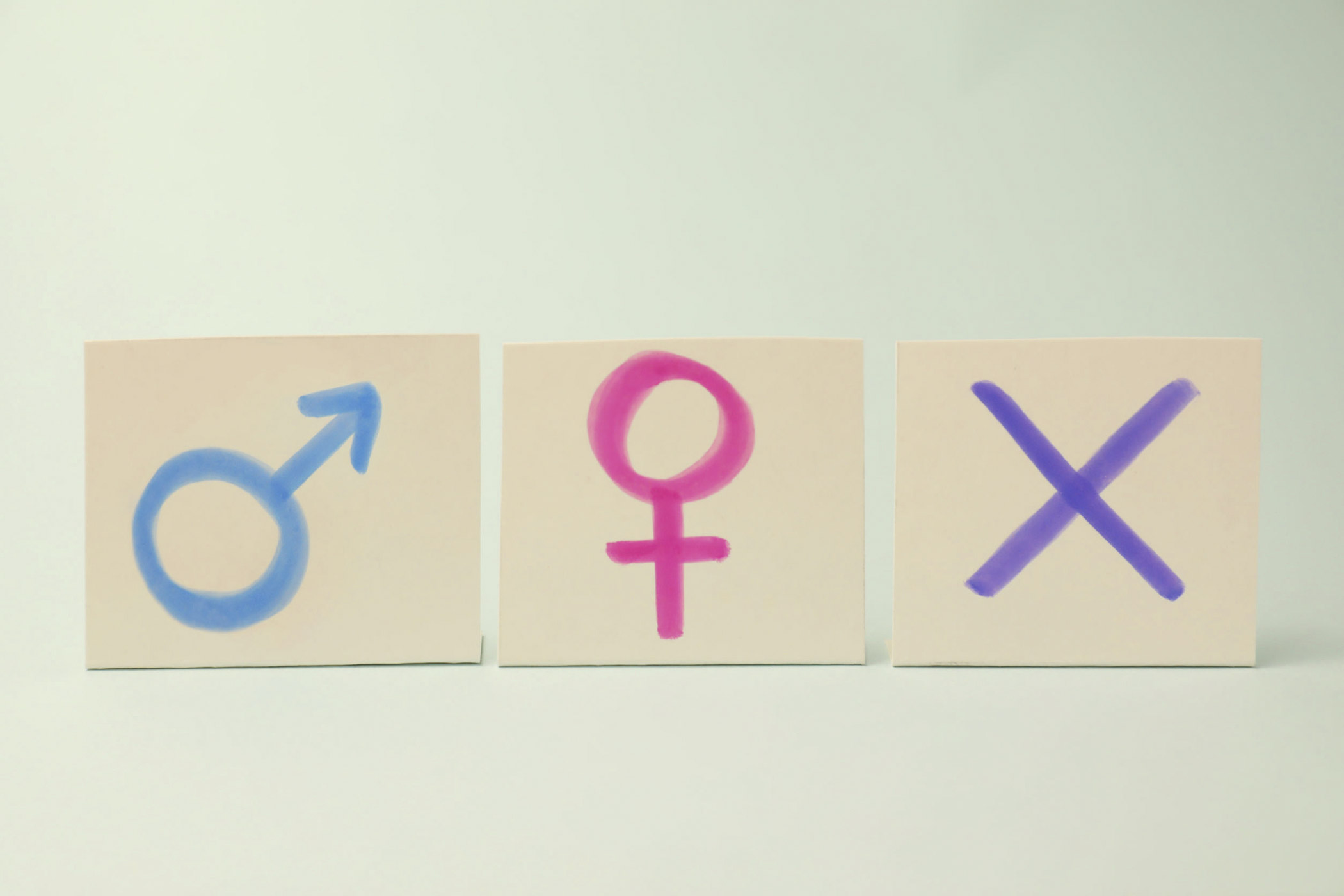Der Beginn der Covid-19-Pandemie liegt mittlerweile fünf Jahre zurück. Noch immer gehen allerdings einige Varianten des Sars-CoV-2-Virus um. Zudem leiden einige Menschen selbst Monate oder gar Jahre nach der Ansteckung noch an Symptomen wie chronischer Erschöpfung, kognitiven Einschränkungen oder Atemproblemen. In diesen Fällen spricht man von Long Covid. Betroffene sind weniger einsatzfähig, oft über einenContinue reading Long Covid und die Folgen für die Arbeitswelt
Geschlechterneutrale Jobtitel: Diese Möglichkeiten gibt es
m/w/d – bei der Jobsuche begegnen wir dieser Abkürzung in nahezu jeder Stellenbeschreibung. Mit „männlich/weiblich/divers“ sollen alle Geschlechter angesprochen werden, verpflichtend ist dieses Kürzel jedoch nicht: Dafür gibt es Alternativen. Warum m/w/d fester Teil einer Stellenbeschreibung geworden ist Zugegeben, besonders elegant wirkt dieser Zusatz direkt im Titel einer Stellenausschreibung nicht. Für Unternehmen stellt „m/w/d“ jedochContinue reading Geschlechterneutrale Jobtitel: Diese Möglichkeiten gibt es →