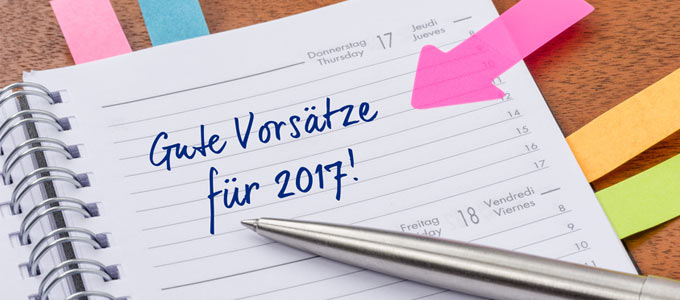Laut Schätzungen der EU benötigt man in naher Zukunft in ca. 90% aller Berufe digitales Know-How. Viele Erwachsene verfügen jedoch lediglich über rudimentäre Kenntnisse auf diesem Gebiet, ein Viertel aller Deutschen über 18 Jahren können sogar als digitale Analphabeten bezeichnet werden. Der Blick auf den Nachwuchs fällt leider auch eher durchwachsen aus. Zwar gehören digitaleContinue reading Digitalisierte Arbeitswelt: Droht Deutschland der Abstieg?
Office Design – Spannende Trends in der Bürogestaltung
Ein gutes Gehalt, rauschende Firmenpartys und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten reichen heutzutage häufig nicht mehr aus, um kluge Köpfe langfristig an ein Unternehmen zu binden. Für viele Arbeitnehmer spielen andere Faktoren eine ebenso wichtige Rolle, z.B. die ideale Work-Life-Balance, die Vereinbarkeit von Job und Familie oder die Möglichkeit, einen Teil der Arbeit im Home Office erledigen zuContinue reading Office Design – Spannende Trends in der Bürogestaltung →
Bürowand gestalten: Wie sich Farben auf unsere Arbeit auswirken
Eine Bürowand zu gestalten zählt zu den einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, das Arbeitsklima und die Produktivität zu beeinflussen. Der Wirkung von Farben kann sich niemand entziehen: Bewusst eingesetzt, lenken sie Stimmungen, stimulieren Konzentration und Leistungsvermögen und verändern Räume in ihrer Größenwirkung. Wer sich in der psychologischen und ästhetischen Wirkung von Farben auskennt, kann seine ArbeitsumgebungContinue reading Bürowand gestalten: Wie sich Farben auf unsere Arbeit auswirken →
Studie: Mehr Gehalt oder mehr Urlaub – was ist Jobsuchenden wichtiger?
Ist das Gehalt alles entscheidend, oder nehmen Bewerber für ein positives Arbeitsumfeld sogar Abstriche beim Einkommen in Kauf? Dieser Frage ist das Forsa-Institut im Auftrag der HIH Real Estate nachgegangen. Das wichtigste Ergebnis der Umfrage vorweg: Die Entscheidung zwischen mehr Geld oder mehr Urlaub fällt eindeutig zugunsten der freien Tage und anderer weicher Faktoren aus.Continue reading Studie: Mehr Gehalt oder mehr Urlaub – was ist Jobsuchenden wichtiger? →
Pendlerverkehr – der reine Wahnsinn
Schon wieder ein Stau. Die Bahn hat Verspätung. Im Bus riecht es schon morgens etwas merkwürdig. Das neue Mitglied der Fahrgemeinschaft hört einfach nicht auf zu plappern … Viele Pendler haben auf ihrem langen Weg zur Arbeit schon so einiges erlebt – Hektik und schlechte Laune inklusive. Im Wikipedia-Eintrag (abgerufen am 03.05.2017) werden Pendler „alsContinue reading Pendlerverkehr – der reine Wahnsinn →
Die 4-Stunden-Woche: Ein Konzept für die Zukunft?
Wer kennt sie nicht? Arbeitstage, die früh beginnen und dennoch nicht enden wollen. Da klingt eine 4-Stunden-Woche wie ein Traum … Doch genau mit diesem Titel eroberte ein Buch die Arbeitswelt, das im April 2007 erschien: „The 4-Hour Workweek“. Der Autor Timothy Ferriss umreißt darin ein Arbeitsmodell, in dem der Faktor Arbeit nicht anhand vonContinue reading Die 4-Stunden-Woche: Ein Konzept für die Zukunft? →
Nomophobie: Haben auch Sie Angst, nicht mehr erreichbar zu sein?
Die Liste der Phobien ist lang. Dazu gehört seit einigen Jahren auch die Nomophobie, die „No mobile phone phobia“. Diese krankhafte Angst vor einem nicht vorhandenen oder nicht funktionierenden Smartphone greift auch im Berufsleben um sich. Es gibt bestimmte Symptome, an denen diese Krankheit erkannt werden kann. Ebenso sind Strategien entwickelt worden, wie sich dieContinue reading Nomophobie: Haben auch Sie Angst, nicht mehr erreichbar zu sein? →
Steuer-Urteil: So können Sie ein geteiltes Arbeitszimmer doppelt absetzen
Ein geteiltes Arbeitszimmer doppelt absetzen – das ist seit Dezember 2016 möglich! Vorher wurden Arbeitszimmer-Aufwendungen steuerlich noch rein objektbezogen behandelt, der steuerliche Freibetrag von 1.250 Euro konnte nur einmal abgezogen werden. Ein Grundsatzurteil des Bundesfinanzhofs (BFH) gewährt diesen Freibetrag jetzt jedem Nutzer. Arbeitszimmer doppelt absetzen – ein zeitgemäßes Urteil Viele Arbeitnehmer nutzen im RahmenContinue reading Steuer-Urteil: So können Sie ein geteiltes Arbeitszimmer doppelt absetzen →
Das Smartphone absetzen: So lassen sich Steuern sparen
Im digitalen Zeitalter ist das Smartphone nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im beruflichen Alltag zu einem unverzichtbaren Begleiter geworden. Lässt sich also das Smartphone von der Steuer absetzen? Die Antwort lautet ja: Wenn das Handy regelmäßig für berufliche Zwecke genutzt wird, lassen sich sowohl die Anschaffungs- als auch die Betriebskosten absetzen. DasContinue reading Das Smartphone absetzen: So lassen sich Steuern sparen →
Arbeitszimmer zu Hause absetzen – das geht trotz Büro beim Arbeitgeber
Ein Arbeitszimmer in den eigenen vier Wänden bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich. Doch wer nicht selbstständig ist und einen Arbeitsplatz bei seinem Arbeitgeber hat, konnte die Kosten für das zusätzliche Homeoffice bislang nicht steuerlich geltend machen. Ein aktuelles Gerichtsurteil hat die Rechtsprechung nun angepasst – und es einem Angestellten erlaubt, unter bestimmtenContinue reading Arbeitszimmer zu Hause absetzen – das geht trotz Büro beim Arbeitgeber →
Arbeit 4.0: DAS sind die Chancen und Risiken der Digitalisierung
Die Digitalisierung ist ein unaufhaltsamer Prozess, der unseren Lebensalltag immer umfassender verändert. Der Begriff Arbeit 4.0 beschreibt dabei die Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt und sämtliche Berufsbranchen. Welche Chancen und Risiken birgt die Digitalisierung für das Arbeitsleben? Die Chancen von Arbeit 4.0 Der digitale Wandel revolutioniert den Arbeitsalltag und geht mit einer ganzen Reihe vonContinue reading Arbeit 4.0: DAS sind die Chancen und Risiken der Digitalisierung →
Computerarbeit und Pausen: Wie viele PC-Stunden sind ungesund?
Im digitalen Zeitalter gehört die Computerarbeit für viele Menschen zum Berufsalltag. Die stundenlangen Arbeitsphasen vor dem Bildschirm stellen eine enorme Belastung dar und können zu gesundheitlichen Problemen führen – Computerarbeit ohne Pausen erhöht das Risiko deutlich. Die Folgen von Computerarbeit ohne Pausen Pausenlose Computerarbeit kann eine ganze Reihe von körperlichen Beschwerden mit sich bringen: DazuContinue reading Computerarbeit und Pausen: Wie viele PC-Stunden sind ungesund? →
Vorsätze fürs neue Jahr: Die besten Tricks und Tools gegen Aufschieberitis
Gute Vorsätze für das neue Jahr zu formulieren, ist für viele Menschen ein wichtiges Ritual. Doch um die gesteckten Ziele auch zu erreichen, muss das permanente Aufschieben verhindert werden. Ein mühsames Unterfangen. Was hilft wirklich gegen die alljährliche „Aufschieberitis“? Wie Aufschieben die Vorsätze fürs neue Jahr ruiniert Das dauerhafte Aufschieben von Aufgaben und Erledigungen zähltContinue reading Vorsätze fürs neue Jahr: Die besten Tricks und Tools gegen Aufschieberitis →
Jahresrückschau: Drei spannende Büro-Trends 2016
Welche Büro-Themen gingen 2016 durch die Medien? Was beeinflusste im vergangenen Jahr unseren Office-Alltag? Hier unsere Jahresrückschau auf drei Büro-Trends aus der Arbeitswelt. Büro-Trend Industrie 4.0: Technik frisst Arbeit – oder doch nicht? Dank langsamer und komplizierter Büro-Technik verlieren Angestellte durchschnittlich 10.000 Minuten im Jahr. Knapp 20 Arbeitstage futsch, so nebenbei. Die Ergebnisse der großangelegtenContinue reading Jahresrückschau: Drei spannende Büro-Trends 2016 →
Büro absetzen: Wer darf wieviel steuerlich geltend machen?
Ein Büro in den eigenen vier Wänden bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. Aber lässt sich ein heimisches Büro auch absetzen? Wer kann ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich geltend machen? Wir haben die wichtigsten Informationen und Tipps für 2016/17 zusammengefasst. Büro absetzen: Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen Wenn Ihnen Ihr Arbeitgeber keinen eigenen ArbeitsplatzContinue reading Büro absetzen: Wer darf wieviel steuerlich geltend machen? →
Büro-Planung (Teil 3): Wie Sie das Büro-Klima optimieren
Motivierte Mitarbeiter sind von zentraler Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens. Neben einer angemessenen Bezahlung spielt dabei auch die Einrichtung des Büros eine wichtige Rolle. Aber welche Maßnahmen sind wirklich sinnvoll und sorgen für ein verbessertes Büro-Klima? Büro-Klima: Darum ist die Arbeitsumgebung so wichtig Wer sich in seinem Arbeitsumfeld unwohl fühlt und in einem schlechtenContinue reading Büro-Planung (Teil 3): Wie Sie das Büro-Klima optimieren →
Effizienter und produktiver arbeiten: So profitieren Sie von der Getting-Things-Done-Methode
Ein optimales Selbstmanagement ist der Schlüssel zu mehr Produktivität. Die Methode Getting Things Done (GTD) von David Allen zählt zweifelsfrei zu den effektivsten Strategien, um möglichst effizient und produktiv arbeiten zu können. Zu den wichtigsten Faktoren der GTD-Methode gehören sinnvolle Kategorisierungen und regelmäßige Aktualisierungen Ihrer Aufgaben. Die Grundlagen der Getting-Things-Done-Methode Die Basis der GTD-MethodeContinue reading Effizienter und produktiver arbeiten: So profitieren Sie von der Getting-Things-Done-Methode →
Warum halten Drucker im Büro häufig länger als zuhause?
Ob im privaten Haushalt oder in der Firma – Drucker gehören zur technischen Grundausstattung. Aber warum gehen sie zu Hause so schnell kaputt? Obwohl sie dort doch viel weniger genutzt werden als Drucker im Büro? Hier die überraschend simple Antwort und Infos, welche Modelle sich für die verschiedenen Einsatzbereiche eignen. Wieso halten Drucker imContinue reading Warum halten Drucker im Büro häufig länger als zuhause? →
Internetsucht: So erkennen Sie erste Anzeichen
Das Internet ist das mit Abstand wichtigste Medium im digitalen Zeitalter – die Internetsucht gehört zu den Schattenseiten dieser Entwicklung: Laut der bislang größten Onlinesucht-Studie vom Bundesministerium für Gesundheit ist 1 Prozent der 14- bis 64-Jährigen in Deutschland internetabhängig. Weitere 4,6 Prozent gelten als problematische Internetnutzer. Demnach gibt es hierzulande mehr Internetsüchtige als Glücksspielabhängige. Logisch,Continue reading Internetsucht: So erkennen Sie erste Anzeichen →
Büroplanung (Teil 1): Die Bürosuche – Direktmiete oder Coworking-Arbeitsplatz?
Die Auswahl eines geeigneten Büros ist ein wichtiger Teilschritt bei der Gründung eines Unternehmens. Dabei fällt die Entscheidung oft zwischen der klassischen Direktmiete und einem Coworking-Arbeitsplatz. Welche Variante die beste Lösung darstellt, hängt unter anderem von der Größe des Start-ups und dem zur Verfügung stehenden Budget ab. Coworking-Arbeitsplatz: Flexible Arbeitsgemeinschaft für Selbstständige Ein Coworking-ArbeitsplatzContinue reading Büroplanung (Teil 1): Die Bürosuche – Direktmiete oder Coworking-Arbeitsplatz? →