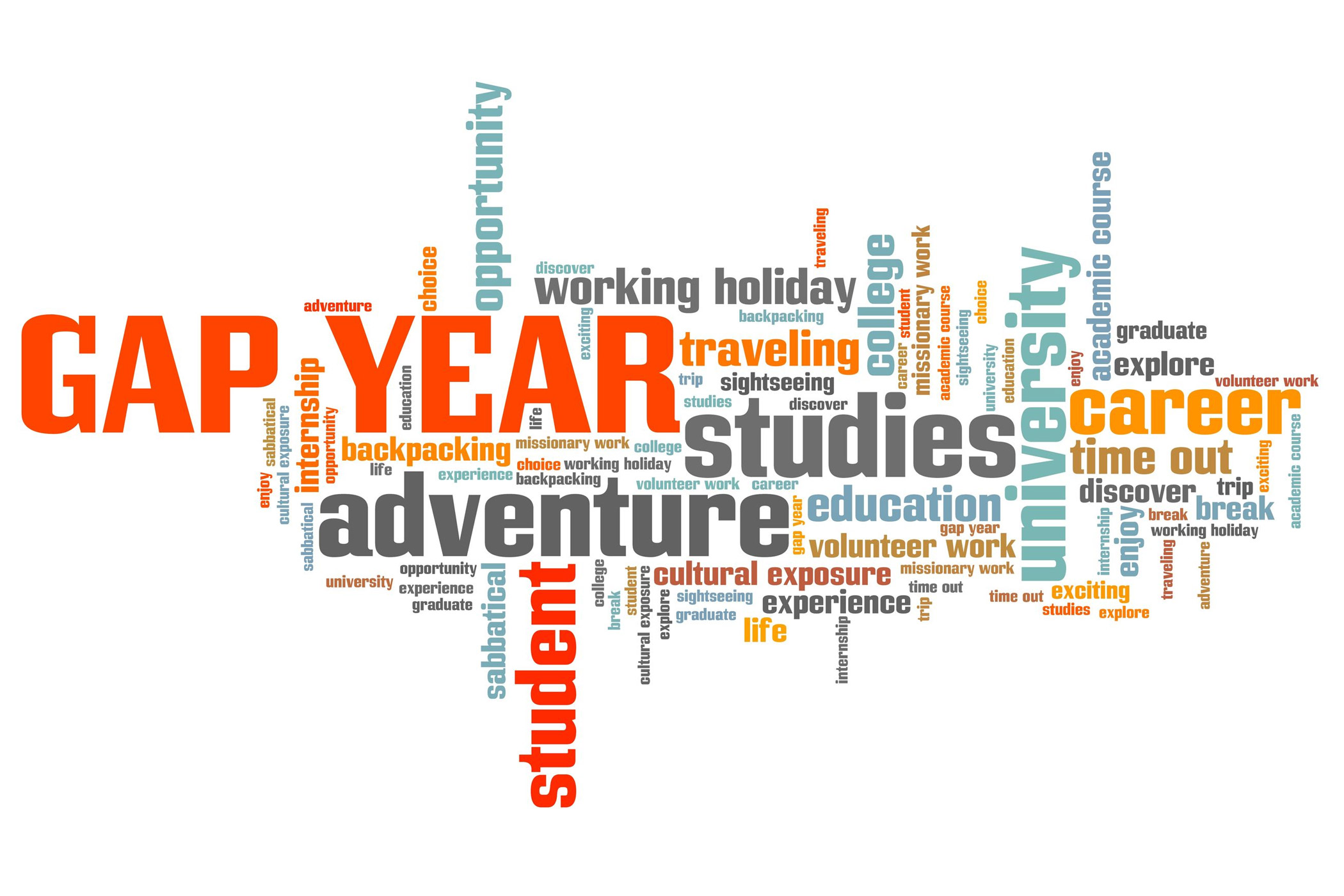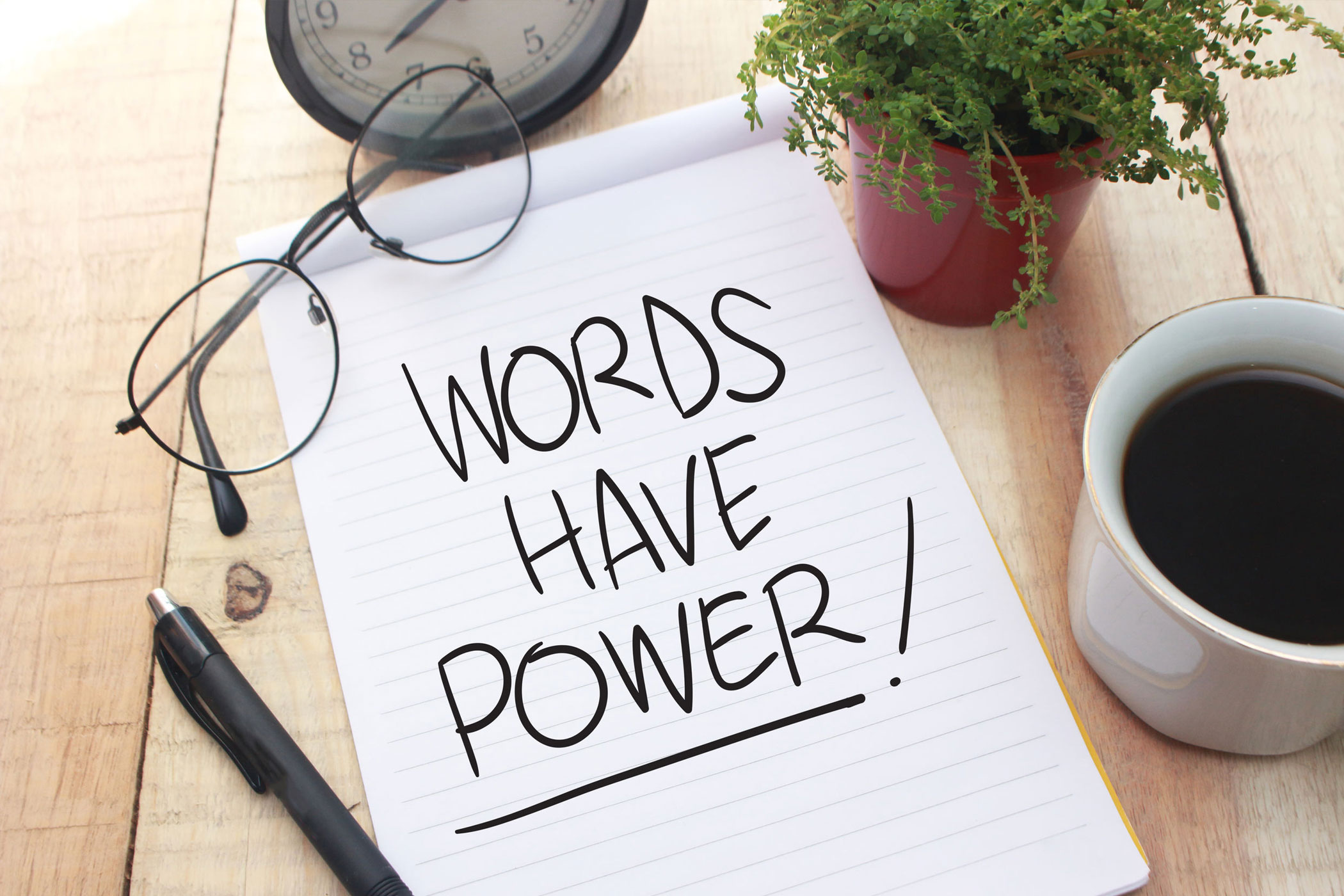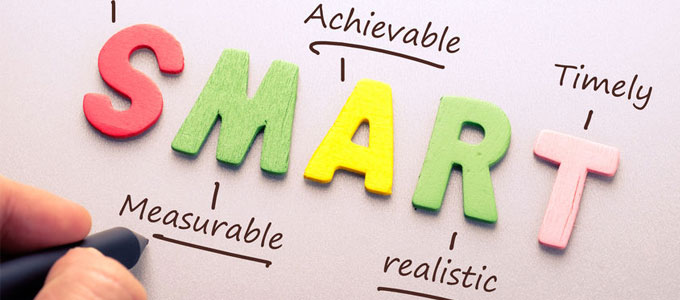Viele Angestellte glauben, um Karriere zu machen, müssten sie als Erster im Büro sein und als Letzter gehen. Was gäbe es immerhin für eine bessere Art, dem Chef das eigene Engagement zu demonstrieren? Falsch! Um Leistung und Engagement zu zeigen, ist nicht die Anzahl der angehäuften Überstunden ausschlaggebend, sondern die Effizienz, mit der Aufgaben erfüllt werden.
Kündigung, Ja oder Nein? 6 Anzeichen dafür, dass Sie Ihren Job wechseln sollten
Im Leben läuft nicht immer alles rund. Stressige Phasen und Situationen, die für Unzufriedenheit sorgen, gehören dazu – auch im Beruf. Doch wenn das schlechte Gefühl am Arbeitsplatz zum Normalzustand wird und sich anderweitig an der Situation nichts ändern lässt, ist es möglicherweise Zeit für einen Jobwechsel. Ist das eigentlich normal? Dauerfrust am Arbeitsplatz, eineContinue reading Kündigung, Ja oder Nein? 6 Anzeichen dafür, dass Sie Ihren Job wechseln sollten →
Gap Year: Was ist das und wie nutzen Sie es bestmöglich?
Nach dem Schulabschluss direkt weiter zur Ausbildung oder an die Universität? Oder nach dem Bachelor-Abschluss direkt weiter zum Masterstudium? Das ist nicht für Jedermann die richtige Wahl. Nach Jahren in der Schule fehlt oft schlicht die Orientierung, wohin die Lebensreise für die nächsten Jahrzehnte überhaupt gehen soll. Ein Gap Year ist eine immer beliebtere Möglichkeit,Continue reading Gap Year: Was ist das und wie nutzen Sie es bestmöglich? →
Argumentieren, erklären oder doch ganz anders? So überzeugen Sie andere
Überzeugend auftreten zu können gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten im Berufsleben. Um andere wirklich für die eigenen Ideen, etwa für Projekte oder Ähnliches, gewinnen zu können, reichen reine Argumente aber oft nicht aus. Mit den richtigen Tipps klappt es mit der Überzeugungskraft. Eine gewonnene Diskussion macht noch kein überzeugtes Gegenüber Im Büroalltag gehören Argumentationen oftContinue reading Argumentieren, erklären oder doch ganz anders? So überzeugen Sie andere →
Job in Gefahr? Diese Zeichen verraten es
Ein (scheinbar) unvorhergesehener Jobverlust ist ein harter Schlag für Arbeitnehmer. Doch wer auf einige Warnzeichen achtet, kann sich bereits frühzeitig auf die unliebsame Offenbarung einstellen – und entweder noch etwas dagegen tun, oder sich schon mal nach Alternativen umsehen. Anzeichen dafür, dass der Job in Gefahr ist Auch wenn es oft den Anschein hat: EinContinue reading Job in Gefahr? Diese Zeichen verraten es →
Mentoren: Diese Typen bringen Sie am meisten weiter
Ein guter Mentor ist nicht nur zum Berufseinstieg echtes Gold wert. Auch darüber hinaus kann er Ihnen mit Rat, Tat, und Kontakten dabei helfen, Ihre Ziele zu erreichen und erfolgreicher zu werden. Die folgenden Mentoren-Typen bringen Sie am meisten weiter. Beschränken Sie sich nicht zwangsläufig auf einen Mentoren Obwohl eine enge Bindung Vorteile haben kann,Continue reading Mentoren: Diese Typen bringen Sie am meisten weiter →
Gründungsfinanzierung: Möglichkeiten und Voraussetzungen
Der Schritt in die Selbstständigkeit ist eine große Sache – und will gut vorbereitet sein. Eine solide Gründungsfinanzierung ist meist unverzichtbar. Lesen Sie hier, welche Möglichkeiten es gibt und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein sollten. Welche Möglichkeiten zur Gründungsfinanzierung gibt es in Deutschland? In Deutschland stehen Ihnen diverse Möglichkeiten zur Gründungsfinanzierung offen. Am häufigsten genutztContinue reading Gründungsfinanzierung: Möglichkeiten und Voraussetzungen →
4-Mal schneller lernen mit der Feynman-Methode
Lebenslanges Lernen gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere. Dass Auswendiglernen nicht immer mit Verstehen gleichzusetzen ist, haben allerdings schon viele Menschen während der Schulzeit festgestellt. Mit der Feynman-Methode können Sie dem entgegenwirken – und Neues viermal schneller lernen. Was ist die Feynman-Methode? Durch pures Auswendiglernen eignen wir uns meist nur oberflächliches WissenContinue reading 4-Mal schneller lernen mit der Feynman-Methode →
Beruf oder Berufung?
Eigentlich fehlen nur das U, das N und das G, um aus einem Beruf eine Berufung zu machen. In der Praxis ist das nicht so einfach. Nur die wenigsten Menschen kennen ihre Berufung schon seit frühen Kindertagen. Manche lernen sie im Laufe des Lebens kennen – häufig nach vielen Irrungen und Wirrungen im Lebenslauf. UndContinue reading Beruf oder Berufung? →
Weiterbildung ist Trumpf: Von zu Hause aus neue Qualifikationen erwerben
Wer im Beruf weiterkommen möchte, für den ist stetige Weiterbildung enorm wichtig. Aber auch im privaten Bereich kann es gut tun, sich neue Horizonte zu erschließen. Dafür brauchen Sie sich nicht in Ihrer Freizeit in einen Seminarraum zu bemühen oder viel Geld zu investieren. Mit den richtigen Tipps gelingt die Weiterbildung auch bequem von zuContinue reading Weiterbildung ist Trumpf: Von zu Hause aus neue Qualifikationen erwerben →
Entspannt an den Hörer: 5 Tipps gegen Telefonangst
Rote Flecken im Gesicht, Angstschweiß auf der Stirn, Atemnot – nur, weil das Telefon klingelt? Das kann vor allem im Büro oder im Homeoffice problematisch werden, wenn das Telefonieren zu Ihrem Aufgabenbereich gehört. Wie sich die Telefonangst äußert und wie Sie sie überwinden können, erfahren Sie im Folgenden. Telefonangst – das sind die Symptome EineContinue reading Entspannt an den Hörer: 5 Tipps gegen Telefonangst →
12 Tipps für den Besuch einer Jobmesse
Ob Sie gerade mit Ihrem Berufsleben starten, aktuell arbeitssuchend sind oder sich aus der Sicherheit eines festen Jobs heraus nach neuen Herausforderungen umschauen möchten – öffentliche Jobmessen und Karrieremessen sind hervorragende Gelegenheiten, um einem Traumjob näher zu kommen. Damit der Besuch der Messe ein Erfolg wird, sollten Sie sich gut darauf vorbereiten und möglichst wenigContinue reading 12 Tipps für den Besuch einer Jobmesse →
Managerkompetenzen verbessern mit Executive Coaching
Führungskräfte haben es im Berufsleben weit nach oben geschafft. Aber auch Manager und leitende Angestellte können sich noch weiterentwickeln – etwa beim Executive Coaching. Lesen Sie hier, was hinter der Coaching-Variante steckt. Warum ist Executive Coaching sinnvoll? Bei einem Coaching im Berufsleben begleitet ein Coach (Karriereberater) den Coachee (seinen Kunden), um dessen berufliche Fähigkeiten zuContinue reading Managerkompetenzen verbessern mit Executive Coaching →
Nicht-Kompetenz kompensieren – was es damit auf sich hat
Die eigene Nicht-Kompetenz zu kompensieren ist eine Fähigkeit, die viele Arbeitnehmer auszeichnet – und es ist häufig ihre einzige. Aber was verbirgt sich hinter diesem Begriff und wie kann ich mit Kollegen umgehen, die sich mit ihrer Inkompetenz vor der Arbeit drücken? Was bedeutet Inkompetenzkompensationskompetenz? Der Begriff stammt ursprünglich von dem Philosophen Odo Marquard. AnlässlichContinue reading Nicht-Kompetenz kompensieren – was es damit auf sich hat →
Glücklich im Job und trotzdem kündigen? Diese Gründe sprechen dafür
Schlechte Arbeitsatmosphäre, willkürliche Beförderungen, keine Wertschätzung: Es gibt viele Gründe für eine Kündigung. Aber selbst für zufriedene Arbeitnehmer kann ein Jobwechsel eine Option sein – auch wenn das auf den ersten Blick paradox klingt. Kündigung: Es muss nicht immer Unzufriedenheit sein Wer seinen Job gerne macht, kann sich eigentlich glücklich schätzen. Umso unverständlicher mag esContinue reading Glücklich im Job und trotzdem kündigen? Diese Gründe sprechen dafür →
Bauernschläue: Diese Potenziale bergen smarte Charaktere
Man selbst hat ein gutes Fachwissen, bildet sich fort, macht Überstunden, zeigt stets Einsatz – und kommt beruflich doch nicht voran. Was hat einem der Kollege voraus, der schon wieder befördert wurde? Eigentlich nichts, außer seiner Bauernschläue. Was sich hinter dem Begriff verbirgt und warum diese Eigenschaft beruflich von Vorteil sein kann, erfahren Sie hier.Continue reading Bauernschläue: Diese Potenziale bergen smarte Charaktere →
So werden Sie zum Sympathieträger
Irgendwo im Büro zeigt ein Kollege das Foto eines Hundewelpen und Sie hören nur: “Wie süß.” Ein kleiner Vierbeiner ist eben ein echter Sympathieträger. Doch was ist es, was das Hundebaby so sympathisch macht? Und lassen sich die Eigenschaften eigentlich auch auf Menschen übertragen? Erfahren Sie, mit welchen Verhaltensweisen Sie auf der Beliebtheitsskala nach obenContinue reading So werden Sie zum Sympathieträger →
Think different: Mit Kreativität den Erfolg steigern
Ob als Mittel zur Problemlösung oder für die Entwicklung neuer Produkte: Kreativität ist ein Schlüssel zum Erfolg und deshalb oft als Soft Skill bei Unternehmen gefragt. Doch nicht jeder sprudelt einfach so über vor Ideen. Mit diesen Tricks können Sie Ihr kreatives Potenzial gezielt fördern. Die richtige Umgebung für kreative Einfälle Das Arbeitsleben geht oftContinue reading Think different: Mit Kreativität den Erfolg steigern →
Selbstständigkeit: Das sind die wichtigsten Versicherungen
Vom Businessplan über Markenschutz bis hin zur richtigen Rechtsform: Unternehmensgründer haben vorab einiges zu bedenken. Dazu gehört auch der richtige Versicherungsschutz. Welchen Schutz Sie konkret benötigen, hängt letztlich vom gewählten Geschäftsmodell ab. Über diese Versicherungen sollten Sie sich als angehender Selbstständiger aber in jedem Fall informieren. Persönliche Risiken absichern Kranken- & Pflegeversicherungen: Die Krankenversicherung istContinue reading Selbstständigkeit: Das sind die wichtigsten Versicherungen →
Falsche Freunde im Job – und wie Sie sie loswerden
Echte Freunde sind eine Bereicherung, unechte das genaue Gegenteil. Vordergründig gaukeln sie Ihnen vor, Sie in allen Belangen zu unterstützen. In Wahrheit spielen sie ein falsches Spiel. Solche Menschen tauchen nicht nur im Privatleben auf, sondern ebenso auf der Arbeit. Bevor Sie sich wieder von falschen Freunden befreien können, müssen Sie sie zunächst erkennen. WoranContinue reading Falsche Freunde im Job – und wie Sie sie loswerden →