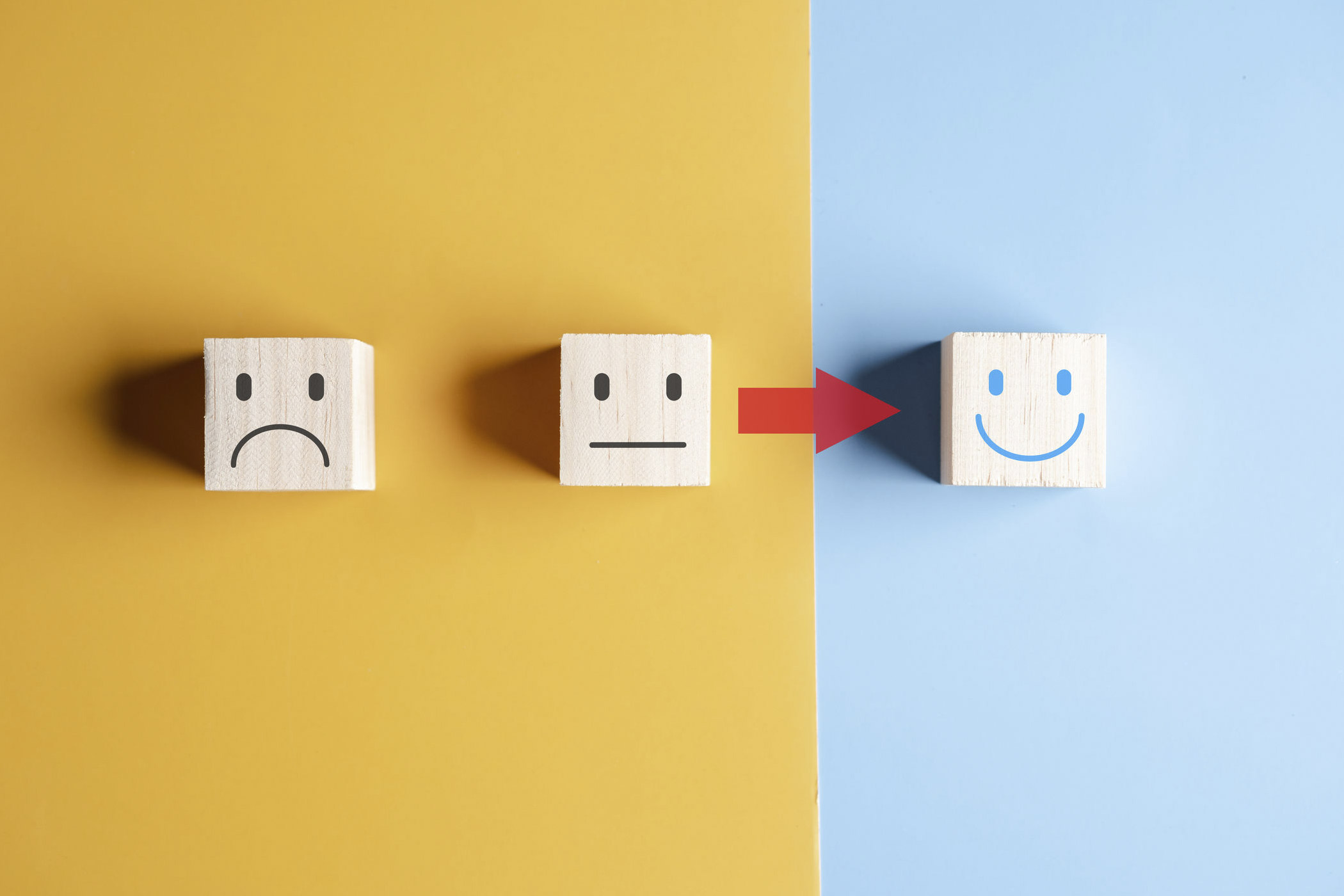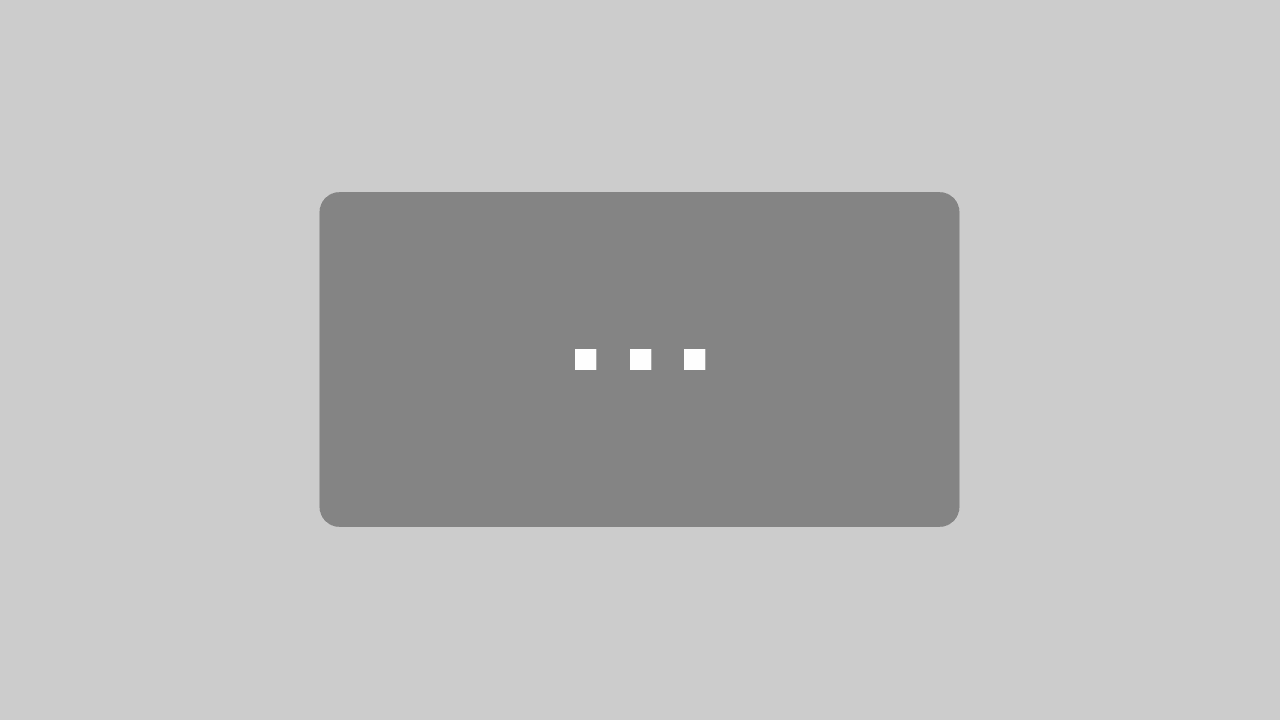Weekend Blues – schlecht gelaunt am Wochenende?
Ausschlafen, Zeit mit der Familie und Freunden verbringen, sich den Hobbys widmen – das Wochenende sollte eigentlich eine Zeit der guten Laune sein. Es gibt jedoch Menschen, bei denen schlägt der Weekend Blues zu: Kaum steht das Wochenende vor der Tür, zieht schlechte Stimmung auf. In der Wissenschaft bezeichnet man dieses Phänomen auch als Sonntagsneurose.
Hier erfahren Sie mehr über die Ursachen, Risiken und Gegenmaßnahmen.
Die Sonntagsneurose: Wenn am Wochenende schlechte Laune aufzieht
Eine Neurose bezeichnet in der Medizin eine psychische Störung oder neurotische Depression. Von Sonntagsneurose oder Weekend Blues spricht man, wenn Menschen am Wochenende besonders schlechte Stimmung haben. Dabei handelt es sich um ein grundlegend anderes Phänomen als das Bauchgrummeln am Sonntagabend, das bei vielen Menschen beim Gedanken an den Montagmorgen aufkommt.
Neben schlechter Laune treten beim Weekend Blues noch weitere Symptome auf:
– Anhaltender Stress an den freien Tagen
– Frust und Niedergeschlagenheit
– Mangelnde Motivation
– Depressive Gedanken
– Körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Probleme
Höherer Bildungsstand, mehr Weekend Blues
Der Weekend Blues ist kein neues Phänomen. Der ungarische Psychoanalytiker Sánder Ferenczi untersuchte die Sonntagsneurose bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts und beschrieb die körperlichen Symptome seiner Patienten. Die Ursachen für die Niedergeschlagenheit am Wochenende sind allerdings noch nicht vollständig erforscht.
Wie Ökonomen der Universität Hamburg herausgefunden haben, sind Männer häufiger von der Sonntagsneurose betroffen als Frauen. Zudem steigt das Risiko für den Weekend Blues mit dem Bildungsgrad. Auch gut ausgebildete Frauen sind betroffen, allerdings nicht in gleichem Maße.
Büroarbeiter, vor allem Führungskräfte, gehören zu den typischen Betroffenen einer Sonntagsneurose. Am Wochenende plagen sie sich mit Niedergeschlagenheit und Frust, am Montag steigt ihre Stimmung wieder sprunghaft an. Über die Gründe gibt es verschiedene Vermutungen:
– Betroffene plagen sich mit der Angst vor dem Stress, der in der kommenden Woche ansteht.
– Die Freizeit am Wochenende wird als Zeitverschwendung empfunden, da sie der Bearbeitung wichtiger Aufgaben im Wege steht.
– Vor allem Führungskräfte definieren sich oft über ihre berufliche Leistung. Ruht die Arbeit, fehlt ihnen diese Möglichkeit.
– Das moderne Arbeitsleben mit ständiger Erreichbarkeit sowie zeitlicher und räumlicher Flexibilität verursacht zusätzlich Stress.
Ein weiterer Grund für den Weekend Blues kann Freizeitstress darstellen. Die meisten Berufstätigen kennen das Phänomen: Statt sich an freien Tagen zu entspannen, sind erst noch all die Aufgaben zu erledigen, die unter der Woche liegen geblieben sind. Bevor Sie sich aufs Sofa legen, müssen Sie die Wohnung putzen, einkaufen, das Altglas wegbringen – die angebliche Freizeit steht Ihnen also tatsächlich nicht frei zur Verfügung.
Weekend Blues steigert das Burn-out-Risiko
Können Sie sich am Wochenende nicht von den Belastungen der Arbeitswoche erholen, steigt der Stresspegel. Langfristig hat das negative Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit. Mit anhaltendem Weekend Blues steigt die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und Nierenschäden. Zudem haben Betroffene ein höheres Risiko, einen Burn-out zu erleiden.
Die Folgen der Sonntagsneurose machen sich auch im Büro bemerkbar: Wer unter Weekend Blues leidet, ist weniger belastbar, die Fehlerquote steigt, es kommt zu mehr Fehlzeiten.
Weekend Blues – was tun?
Tritt bei Ihnen regelmäßig der Weekend Blues auf, sollten Sie aktiv werden und etwas dagegen unternehmen. Die folgenden Tipps können dabei helfen, gegen die Sonntagsneurose vorzugehen:
1. Pläne machen
Überlegen Sie sich bereits unter der Woche, welche Aktivitäten Ihnen Freude bereiten. Stellen Sie einen Plan auf, was Sie am Wochenende gerne unternehmen würden. Beschäftigen Sie sich mit dem, was Sie gerne tun, hat der Weekend Blues weniger Chancen.
2. Bewegung an der frischen Luft
Es ist fast schon ein Klischee, aber viel Bewegung an der frischen Luft hilft tatsächlich dabei, trübe Gedanken zu vertreiben und Stress zu lindern. Als positiver Nebeneffekt wird auch das Immunsystem gestärkt. Nutzen Sie das Wochenende also, um spazieren zu gehen, Radtouren zu machen oder draußen Sport zu treiben.
3. Dem Tag einen Rhythmus geben
Brechen Sie am Wochenende aus den gewohnten Abläufen aus, kommt es häufig zum sogenannten Gummiband-Effekt: Aufgrund der schlagartigen Entspannung sinkt der Pegel des Stresshormons Cortisol rapide ab. Der Körper reagiert darauf mit Müdigkeit und Abgeschlagenheit, das Krankheitsrisiko steigt. Behalten Sie daher am besten Ihren gewohnten Tagesablauf bei und geben Sie Ihrem Tag Struktur.
4. Abschalten lernen
Führen Sie eine strikte Trennung von Arbeit und Freizeit ein. Schalten Sie am Wochenende Arbeitshandy und Laptop ab und konzentrieren Sie sich auf das, was Ihnen persönlich guttut.
5. Die neue Arbeitswoche vorbereiten
Dieser Tipp steht etwas im Gegensatz zu Tipp 4. Einigen Betroffenen hilft es jedoch, wenn sie am Wochenende ein paar Stunden mit der Vorbereitung der neuen Arbeitswoche verbringen, zum Beispiel To-do-Listen für die kommenden Tage erstellen.
6. Professionelle Hilfe suchen
Hält der Weekend Blues über längere Zeit an und wirkt sich auf Ihre Arbeitsleistung aus, sollten Sie professionelle ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Eventuell steckt nämlich eine Depression hinter der Niedergeschlagenheit und Lustlosigkeit am Wochenende.
Urheber des Titelbildes: champlifezy/ 123RF Standard-Bild