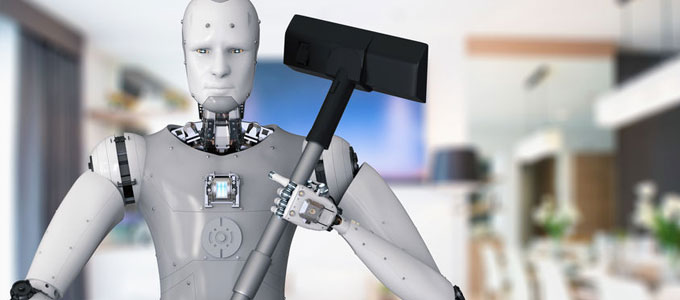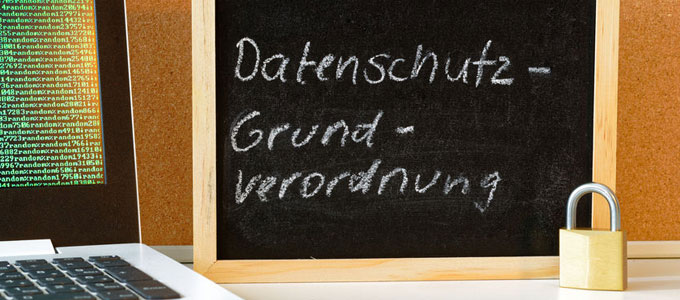Inzwischen fürchten immer mehr Menschen, dass Ihre Jobs obsolet werden. Die technische Entwicklung marschiert unaufhaltsam voran. War es bislang das Fließband, dass viele Arbeiter ersetze, sind es immer häufiger – mit künstlicher Intelligenz ausgestattete – Roboter, die menschliche Jobs übernehmen. Kann ein Saugroboter schon heute eine klassische Putzfrau bzw. Putzkraft adäquat ersetzen? Hier finden SieContinue reading „Kampf der Titanen“ – Saugroboter vs. Putzhilfe
Mikrochips unter der Haut von Mitarbeitern – Sind wir schon soweit?
Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass ein bekanntes Reiseunternehmen seinen Mitarbeitern in Skandinavien die Option anbietet, sich einen Mikrochip unter die Haut verpflanzen zu lassen. Dieser soll den Büroalltag erleichtern. Ein Trend, der auch nach Deutschland überschwappen könnte? Welchen Nutzen und Risiken bringt ein Mikrochip mit sich? Im folgenden Artikel finden Sie Antworten auf dieseContinue reading Mikrochips unter der Haut von Mitarbeitern – Sind wir schon soweit? →
Jobprofil: Der Interimsmanager
Allein der Tagessatz eines Interimsmanagers lässt seinen Beruf ausgesprochen attraktiv erscheinen. Mehr als 1.000 Euro sind keine Seltenheit. Laut „Wirtschaftswoche“ sind sogar Werte bis zu 2.500 Euro marktfähig. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass gerade Unternehmen in Not diese doch erheblichen Kosten schultern. So versteht es sich fast von selbst, dass Interimsmanager besondere LeistungenContinue reading Jobprofil: Der Interimsmanager →
So überwinden Sie den Herbstblues
Wenn die Tage kürzer, kälter und nasser werden, ist die Stimmung bei vielen Menschen im Keller – der Herbstblues setzt ein! Schätzungsweise 17 Prozent der deutschen Bevölkerung macht der Übergang von Sommer auf Herbst zu schaffen. Das ist keine Einbildung, sondern ein weitverbreitetes Problem, mit denen sich selbst Ärzte befassen. Symptome und Anzeichen Der Herbstblues,Continue reading So überwinden Sie den Herbstblues →
Volition: Das Geheimnis zum Erfolg
Volition bedeutet so viel wie Verbissenheit und zählt, mehr noch als Intelligenz, zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren! In welchen Bereichen der Begriff verwendet wird und wie sich Volition trainieren lässt, lesen Sie hier! Never give up: Erfolgsfaktor Volition Volition, also der Wille, etwas zu erreichen, ist wichtiger als Intelligenz – soweit die These. Die Eigenschaft verspricht,Continue reading Volition: Das Geheimnis zum Erfolg →
Bewegung und frische Luft: So entspannt die Mittagspause
Das Telefon klingelt in einer Tour, im Postfach stauen sich Dutzende ungelesene E-Mails, im Terminkalender stapeln sich die Meetings: Vor lauter Stress kann einem da schon mal der Kopf qualmen. Glücklicherweise steht die Mittagspause bevor. Warum Sie die unbedingt an der frischen Luft verbringen sollten, erfahren Sie hier! Hilft gegen Stress Der Anblick von Aktenstapeln,Continue reading Bewegung und frische Luft: So entspannt die Mittagspause →
Depressiver Kollege: Was ist zu tun?
Depressionen sind nach Rückenschmerzen Volkskrankheit Nummer 2! Gerade am Arbeitsplatz zeigt sich die Schwierigkeit im Umgang mit einem depressiven Kollegen. Denn während der Betroffene leidet, wissen Kollegen häufig nicht, wie sie mit der Krankheit des Mitarbeiters umgehen sollen. Wie Sie ein vertrauliches Gespräch mit Ihrem Kollegen führen, erfahren Sie hier! Wie würden Sie behandelt werdenContinue reading Depressiver Kollege: Was ist zu tun? →
Tipps zum Lebenslauf: Beim Personaler punkten
Neben dem Bewerbungsschreiben ist der Lebenslauf wesentlicher Bestandteil der Bewerbung. Er dient den HR-Fachleuten zur schnellen Einschätzung der beruflichen Fähigkeiten und der Persönlichkeit des Bewerbers. Mit ein paar Tricks hebt er sich positiv von den Mitbewerbern ab. Die angestrebte Position im Unternehmen erwähnen In den Lebenslauf gehören die Ausbildung, der berufliche Werdegang, besondere Fähigkeiten undContinue reading Tipps zum Lebenslauf: Beim Personaler punkten →
Kurze Pausen: Darum sind sie im Job so wichtig
Durchpowern war gestern: Wer pro Arbeitsstunde einige Minuten Pause macht, arbeitet effizienter. Wir benötigen diese Auszeiten, um dauerhaft leistungsfähig zu sein. Alle 60 Minuten eine kurze Siesta Alle 60 bis 90 Minuten ist laut ärztlicher Empfehlung eine kurze Pause im Job angebracht. Der Hintergrund ist, dass der Mensch nicht fürs Durcharbeiten geschaffen ist. Wird dasContinue reading Kurze Pausen: Darum sind sie im Job so wichtig →
Auf ins Sabbatical – Anreize und Ideen für Ihre Auszeit!
Einfach mal eine Auszeit nehmen – das ist für viele Arbeitnehmer und Freiberufler ein Traum. Für andere längst zur Notwendigkeit geworden, damit nicht schon mit 30 der erste Burn-Out droht. In diesem langen „Sonderurlaub“ können Sie natürlich einerseits eine Pause von Ihrer regulären Arbeit bekommen und Abstand gewinnen, andererseits können sich Ihnen aber auch neueContinue reading Auf ins Sabbatical – Anreize und Ideen für Ihre Auszeit! →
Einfach nur Boss oder echte Führungspersönlichkeit?
Was macht einen guten Abteilungsleiter oder Geschäftsführer aus? Wie kann er die Produktivität seines Teams fördern und den Mitarbeitern ein gutes Gefühl verleihen? Das ist gar nicht schwer, liebe Vorgesetzte: Handfeste Anregungen gibt’s hier. Für Transparenz im Unternehmen sorgen Werden Mitarbeiter nicht über aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen informiert, fühlen sie sich übergangen – Misstrauen gegenüberContinue reading Einfach nur Boss oder echte Führungspersönlichkeit? →
Die Kündigungsschutzklage im Überblick
Viele Arbeitnehmer werden von einer oftmals unerwarteten Kündigung sehr hart getroffen und fragen sich, wie sie sich dagegen wehren können. Halten Sie Ihre Kündigung für unfair, sollten Sie beim Arbeitsgericht eine Kündigungsschutzklage einreichen. Das Gericht prüft, ob die Kündigung tatsächlich wirksam ist. Häufig lautet das Ergebnis, dass die Entlassung nicht rechtens ist. Wenn der AntragContinue reading Die Kündigungsschutzklage im Überblick →
Udemy & Co. – Weiterbildung mit Online-Kursen
In den letzten Jahren hat sich das Angebot für Weiterbildungen auf den digitalen Markt ausgeweitet. Online-Anbieter geben Berufstätigen die Möglichkeit, neben dem Beruf weitere Zusatzqualifikationen zu erwerben. Zu den bekanntesten Portalen für diese Online-Weiterbildungskurse gehört Udemy. In diesem Artikel stellen wir Ihnen das Prinzip von Udemy genauer vor und werfen auch einen Blick auf Wettbewerber.Continue reading Udemy & Co. – Weiterbildung mit Online-Kursen →
Bewerbung 2.0: So gehen Jobsuche und Bewerben heute
Der Begriff „Bewerbung 2.0“ lehnt sich an das „Web 2.0“ an, das die Entwicklung des Internets zum interaktiven Kommunikationsnetz bezeichnet. Social-Media-Kanäle waren und sind beliebte Plattformen zum Austausch von Meinungen, Wissen und privaten Erlebnissen. Analog dazu umschreibt Bewerbung 2.0 die Nutzung von Internetkanälen für die Bewerbung. Xing und LinkedIn, Stepstone und Monster: Wer heute einenContinue reading Bewerbung 2.0: So gehen Jobsuche und Bewerben heute →
Die Kundenzufriedenheit steigern: So geht’s
Kundenzufriedenheit ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Ist der Kunde rundum zufrieden, bindet er sich emotional an eine Firma oder Marke und empfiehlt diese auch weiter. Erlebt der Nutzer dagegen eine Enttäuschung, springt er als Kunde ab. Hier erfahren Sie, wie Sie solche Kunden wieder von Ihrem Unternehmen überzeugen und die ZufriedenheitContinue reading Die Kundenzufriedenheit steigern: So geht’s →
ASAP: Schluss mit Immer-Alles-Sofort!
In der heutigen Berufswelt kann es nicht schnell genug gehen. Auf die Frage, bis wann etwas spätestens erledigt sein soll, lautet die Antwort häufig: ASAP. Selbst die Abkürzung wird genutzt, um Zeit zu sparen. ASAP steht für „as soon as possible“ – doch die Alles-Sofort-Mentalität verursacht oftmals mehr Probleme, als dass sie Lösungen schafft! DarumContinue reading ASAP: Schluss mit Immer-Alles-Sofort! →
DSGVO – die wichtigsten Infos für Unternehmen und Verbraucher
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist seit 25. Mai 2018 in Kraft. Seitdem haben die Anforderungen in Sachen Datenschutz für Unternehmen in vielen Feldern stark zugenommen. Doch auch bei Verbrauchern haben die gesetzlichen Neuerungen vielfach zu Verunsicherung geführt, weil die abzugebenden Erklärungen zum Schutz der persönlichen Daten erheblich länger und meist sprachlich unverständlicher geworden sind. Weshalb wurdeContinue reading DSGVO – die wichtigsten Infos für Unternehmen und Verbraucher →
Tipps für Arbeitnehmer bei (drohender) Insolvenz des Arbeitgebers
Unternehmensinsolvenzen gibt es leider recht häufig. Die Drogeriekette Schlecker und die Fluggesellschaft AirBerlin sind dabei nur die „Spitze des Eisbergs“. Wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen mitteilt, dass er die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt hat, passiert das meistens ziemlich unerwartet. Eine solche Nachricht lässt keinen Mitarbeiter kalt, zumal die berufliche Existenz auf dem Spiel steht. Was geschiehtContinue reading Tipps für Arbeitnehmer bei (drohender) Insolvenz des Arbeitgebers →
Initiativbewerbung – so klappt’s mit dem Traumjob
Etwa 70 Prozent aller Stellen werden unter der Hand vergeben, also ohne öffentliche Stellenausschreibung. Da hilft nur Vitamin B weiter – oder eine Initiativbewerbung. Wie Sie diese verfassen, erfahren Sie hier. Die Initiativbewerbung an den richtigen Empfänger senden Sich auf eine Stelle zu bewerben, obwohl es gar keine Anzeige dafür gibt, ist eine prima Idee.Continue reading Initiativbewerbung – so klappt’s mit dem Traumjob →
Jobwechsel: Nicht vorschnell Gehaltseinbußen akzeptieren
Probleme mit dem Arbeitgeber, Stress im Job, keine langfristigen Perspektiven, mangelnde Mitbestimmung: Diese Gründe führen oftmals zu einem raschen Jobwechsel. Viele Arbeitnehmer nehmen dann sogar ein geringeres Gehalt in Kauf – doch dGehaltseinbußen sollte niemand vorschnell akzeptieren. Klären Sie Ihre Prioritäten Bevor Sie sich für den Jobwechsel entscheiden, sollten Sie genau überlegen, was Sie mitContinue reading Jobwechsel: Nicht vorschnell Gehaltseinbußen akzeptieren →