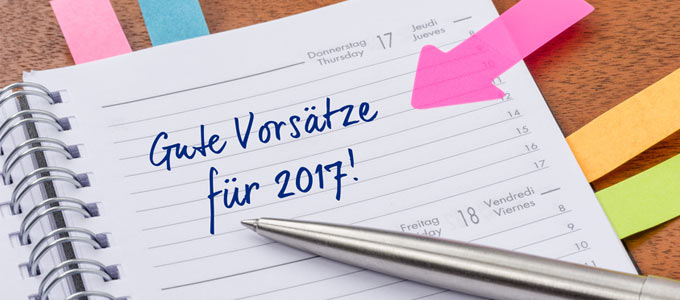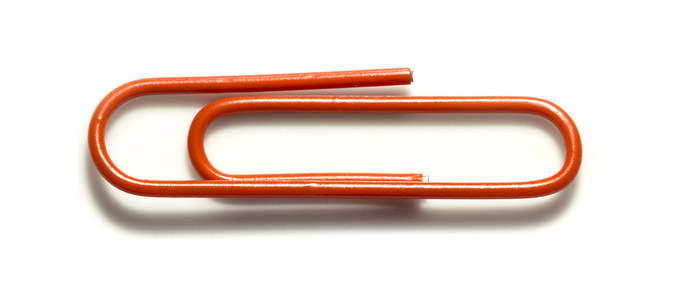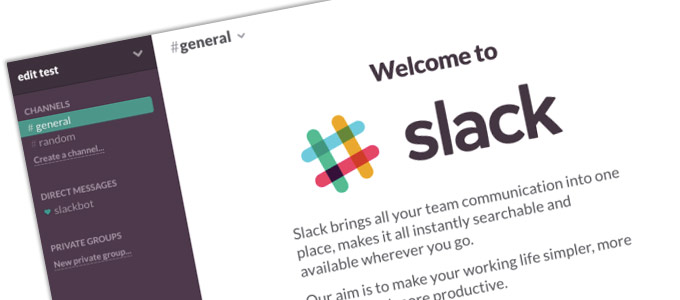Gute Vorsätze für das neue Jahr zu formulieren, ist für viele Menschen ein wichtiges Ritual. Doch um die gesteckten Ziele auch zu erreichen, muss das permanente Aufschieben verhindert werden. Ein mühsames Unterfangen. Was hilft wirklich gegen die alljährliche „Aufschieberitis“? Wie Aufschieben die Vorsätze fürs neue Jahr ruiniert Das dauerhafte Aufschieben von Aufgaben und Erledigungen zähltContinue reading Vorsätze fürs neue Jahr: Die besten Tricks und Tools gegen Aufschieberitis
Jahresrückschau: Drei spannende Büro-Trends 2016
Welche Büro-Themen gingen 2016 durch die Medien? Was beeinflusste im vergangenen Jahr unseren Office-Alltag? Hier unsere Jahresrückschau auf drei Büro-Trends aus der Arbeitswelt. Büro-Trend Industrie 4.0: Technik frisst Arbeit – oder doch nicht? Dank langsamer und komplizierter Büro-Technik verlieren Angestellte durchschnittlich 10.000 Minuten im Jahr. Knapp 20 Arbeitstage futsch, so nebenbei. Die Ergebnisse der großangelegtenContinue reading Jahresrückschau: Drei spannende Büro-Trends 2016 →
Büro absetzen: Wer darf wieviel steuerlich geltend machen?
Ein Büro in den eigenen vier Wänden bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich. Aber lässt sich ein heimisches Büro auch absetzen? Wer kann ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich geltend machen? Wir haben die wichtigsten Informationen und Tipps für 2016/17 zusammengefasst. Büro absetzen: Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen Wenn Ihnen Ihr Arbeitgeber keinen eigenen ArbeitsplatzContinue reading Büro absetzen: Wer darf wieviel steuerlich geltend machen? →
Die besten Apps (Teil 3) … für Logistik und Spedition
Praktische Logistik-Apps erleichtern den Berufsalltag: Für die Logistik- und Transport-Branche gibt es eine ganze Reihe hilfreicher Mobilprogramme. Dazu zählen Apps für eine verbesserte Ladungssicherung und die vereinfachte Parkplatzsuche – hier kommen neun empfehlenswerte Anwendungen. Logistik-App für Telematik-Nutzer Wer das Telematik-System Fleetboard verwendet, kann auch die zugehörigen Fleetboard-Apps nutzen: Die Tools ermöglichen die unkomplizierte PlanungContinue reading Die besten Apps (Teil 3) … für Logistik und Spedition →
Stackfield-Messenger für Unternehmen: Die verschlüsselte Slack-Alternative
Viele Unternehmen nutzen den US-Messenger Slack für die interne Kommunikation. Mit der Cloud-Plattform Stackfield steht aber eine interessante Alternative „Made in Germany“ zur Auswahl, die gegenüber dem großen Rivalen mit verschiedenen Vorteilen punktet. Zum Beispiel mit sicherer Datenverschlüsselung und praktischer Kalenderfunktion. Stackfield steht für besseren Datenschutz Im Gegensatz zu Slack basiert Stackfield auf einerContinue reading Stackfield-Messenger für Unternehmen: Die verschlüsselte Slack-Alternative →
Schlafen im Büro: Warum ein Mittagsschlaf so wichtig sein kann
Der Arbeitsalltag ist oft mit viel Stress und permanentem Leistungsdruck verbunden. Da wäre ein erholsames Schläfchen ab und an doch genau das Richtige, oder? Tatsächlich: In einigen Situationen sind wir so unproduktiv, dass Schlafen im Büro definitiv die bessere Alternative zum Arbeiten darstellt. Schlafmangel – ein guter Grund für das Schlafen im Büro DasContinue reading Schlafen im Büro: Warum ein Mittagsschlaf so wichtig sein kann →
Weihnachtsdeko fürs Büro basteln – 9 kreative Deko-Ideen
In der Adventszeit sorgen festlich beleuchtete Wohnungen, Straßenzüge und Weihnachtsmärkte für eine weihnachtliche Atmosphäre. Wenn auch im Büro Festtagsstimmung aufkommen soll, heißt es: ran an die Weihnachtsdeko und losschmücken! Weihnachtsdeko am Büro-Fenster Für die Dekoration der Bürofenster bietet sich Kunstschnee-Spray an: Mithilfe von Schablonen mit Weihnachtsmotiven, die man auch selbst anfertigen kann, lassen sichContinue reading Weihnachtsdeko fürs Büro basteln – 9 kreative Deko-Ideen →
Die besten Apps (Teil 2) …für Kfz-Betriebe
Im digitalen Zeitalter stehen Autowerkstätten vollkommen neue Möglichkeiten offen: Es gibt eine Vielzahl von praktischen Kfz-Apps und -PC-Programmen, die mit einer enormen Funktionsvielfalt überzeugen. Das Angebot beinhaltet Programme für einen minimierten Bürokratieaufwand und das Auslesen von Fehlercodes – praktisch im Werkstattalltag. Kfz-App zur Analyse des Keilriemens Reparaturen am Keilriemen gehören zum Alltag in Kfz-Betrieben. MitContinue reading Die besten Apps (Teil 2) …für Kfz-Betriebe →
Büro-Planung (Teil 3): Wie Sie das Büro-Klima optimieren
Motivierte Mitarbeiter sind von zentraler Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmens. Neben einer angemessenen Bezahlung spielt dabei auch die Einrichtung des Büros eine wichtige Rolle. Aber welche Maßnahmen sind wirklich sinnvoll und sorgen für ein verbessertes Büro-Klima? Büro-Klima: Darum ist die Arbeitsumgebung so wichtig Wer sich in seinem Arbeitsumfeld unwohl fühlt und in einem schlechtenContinue reading Büro-Planung (Teil 3): Wie Sie das Büro-Klima optimieren →
Batterien entsorgen und Altgeräte recyceln – wie geht das richtig?
Elektronikgeräte und Batterien entsorgen – gesetzeskonform und umweltfreundlich: Aufgrund ihrer beschränkten Lebensdauer werden alte Laptops und leergesaugte Stromspeicher irgendwann aussortiert. Was schreibt der Gesetzgeber für die Entsorgung vor? Wo findet man geeignete Sammelstellen? Wo gibt‘s kostenlose Serviceleistungen? Batterien entsorgen – in Sammelbehältern für Unternehmen Um Batterien zu entsorgen, gibt es in Deutschland besondere gesetzlicheContinue reading Batterien entsorgen und Altgeräte recyceln – wie geht das richtig? →
Effizienter und produktiver arbeiten: So profitieren Sie von der Getting-Things-Done-Methode
Ein optimales Selbstmanagement ist der Schlüssel zu mehr Produktivität. Die Methode Getting Things Done (GTD) von David Allen zählt zweifelsfrei zu den effektivsten Strategien, um möglichst effizient und produktiv arbeiten zu können. Zu den wichtigsten Faktoren der GTD-Methode gehören sinnvolle Kategorisierungen und regelmäßige Aktualisierungen Ihrer Aufgaben. Die Grundlagen der Getting-Things-Done-Methode Die Basis der GTD-MethodeContinue reading Effizienter und produktiver arbeiten: So profitieren Sie von der Getting-Things-Done-Methode →
Mit Büroklammern basteln – 5 genial-praktische Tricks
Büroklammern sind praktische Hilfsmittel für den Arbeitsalltag, ermöglichen die Fixierung mehrerer Papierseiten. Darüber hinaus können Sie mit Büroklammern aber auch basteln und kreative Ideen umsetzen. Dazu zählen zum Beispiel praktische Lesezeichen und vielseitig einsetzbare Heftmarker. Heftmarker mit Büroklammern basteln Wie lassen sich Nachschlagewerke oder Taschenkalender individuell strukturieren? Indem Sie Folgendes aus Büroklammern basteln: NehmenContinue reading Mit Büroklammern basteln – 5 genial-praktische Tricks →
Warum halten Drucker im Büro häufig länger als zuhause?
Ob im privaten Haushalt oder in der Firma – Drucker gehören zur technischen Grundausstattung. Aber warum gehen sie zu Hause so schnell kaputt? Obwohl sie dort doch viel weniger genutzt werden als Drucker im Büro? Hier die überraschend simple Antwort und Infos, welche Modelle sich für die verschiedenen Einsatzbereiche eignen. Wieso halten Drucker imContinue reading Warum halten Drucker im Büro häufig länger als zuhause? →
Die besten Apps (Teil1) …für Ärzte und Mediziner
Fast jeder US-Arzt nutzt Studien zufolge sein Smartphone für berufliche Zwecke. Aber auch in Deutschland können Mediziner von speziellen Apps für Ärzte profitieren und ihren Patienten durch innovative Anwendungen einen zusätzlichen Service anbieten. Das Angebot beinhaltet zum Beispiel Apps zur Vermeidung von Behandlungsfehlern sowie Programme für die vereinfachte Terminverwaltung. Checkme! Klinikstandards Vor Behandlungsfehlern fürchten sichContinue reading Die besten Apps (Teil1) …für Ärzte und Mediziner →
Entsorgung im Büro (Teil 1): Glühbirnen – das korrekte Recycling von Lampen und Leuchten
Eine helle Beleuchtung und eine flexibel einstellbare Platzbeleuchtung – beides ist im Büro unverzichtbar. Um die zugehörigen Lampen und Glühbirnen fachgerecht zu entsorgen, gilt es das Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG) zu beachten. Das ElektroG ist im Jahre 2006 in Kraft getreten und basiert auf den Vorgaben der EU. Dabei geht es unter anderem um dieContinue reading Entsorgung im Büro (Teil 1): Glühbirnen – das korrekte Recycling von Lampen und Leuchten →
Büro-Planung (Teil 2): Welche Tücken hat die Büro-Suche?
Sowohl für große Firmen als auch für Kleinunternehmer sind geeignete Büroräumlichkeiten von großer Bedeutung. Wenn Sie ein Büro suchen, gilt es allerdings, eine ganze Reihe von wichtigen Tipps zu beherzigen, um passende Objekte finden zu können – der individuelle Flächenbedarf und die Lage sind nur zwei Kriterien. Der langfristige Flächenbedarf als Ausgangspunkt der BürosucheContinue reading Büro-Planung (Teil 2): Welche Tücken hat die Büro-Suche? →
Internetsucht: So erkennen Sie erste Anzeichen
Das Internet ist das mit Abstand wichtigste Medium im digitalen Zeitalter – die Internetsucht gehört zu den Schattenseiten dieser Entwicklung: Laut der bislang größten Onlinesucht-Studie vom Bundesministerium für Gesundheit ist 1 Prozent der 14- bis 64-Jährigen in Deutschland internetabhängig. Weitere 4,6 Prozent gelten als problematische Internetnutzer. Demnach gibt es hierzulande mehr Internetsüchtige als Glücksspielabhängige. Logisch,Continue reading Internetsucht: So erkennen Sie erste Anzeichen →
Slack im Büro (Teil 2): Mit diesen Tricks holen Sie mehr aus dem Büro-Messenger raus
Die Messenger-App Slack ermöglicht eine unkomplizierte Kommunikation und eine vereinfachte Arbeitsorganisation. Einige praktische Funktionen übersieht man allerdings leicht: Ob eine automatisierte Korrektur von Rechtschreibfehlern oder die Verwendung des praktischen Slackbots – mit diesen sechs Slack-Tricks lässt sich diese Software noch komfortabler bedienen und effektiver für den Arbeitsalltag nutzen. Slack-Trick 1: Die Einrichtung von GruppenchatsContinue reading Slack im Büro (Teil 2): Mit diesen Tricks holen Sie mehr aus dem Büro-Messenger raus →
Foldback-Clips kreativ nutzen – 11 geniale Lifehacks
Foldback-Clips sind ohne Zweifel äußerst praktische Hilfsmittel für das Zusammenheften von Papierseiten. Diese Klammern eignen sich aber nicht nur für die Dokumentenorganisation im Büro, sondern bieten noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten. So sorgen die Foldback-Klammern zum Beispiel für mehr Übersicht auf dem Schreibtisch und mehr Ordnung in der Büroküche – hier 11 weitere Bastel-Ideen. WieContinue reading Foldback-Clips kreativ nutzen – 11 geniale Lifehacks →
Büroplanung (Teil 1): Die Bürosuche – Direktmiete oder Coworking-Arbeitsplatz?
Die Auswahl eines geeigneten Büros ist ein wichtiger Teilschritt bei der Gründung eines Unternehmens. Dabei fällt die Entscheidung oft zwischen der klassischen Direktmiete und einem Coworking-Arbeitsplatz. Welche Variante die beste Lösung darstellt, hängt unter anderem von der Größe des Start-ups und dem zur Verfügung stehenden Budget ab. Coworking-Arbeitsplatz: Flexible Arbeitsgemeinschaft für Selbstständige Ein Coworking-ArbeitsplatzContinue reading Büroplanung (Teil 1): Die Bürosuche – Direktmiete oder Coworking-Arbeitsplatz? →