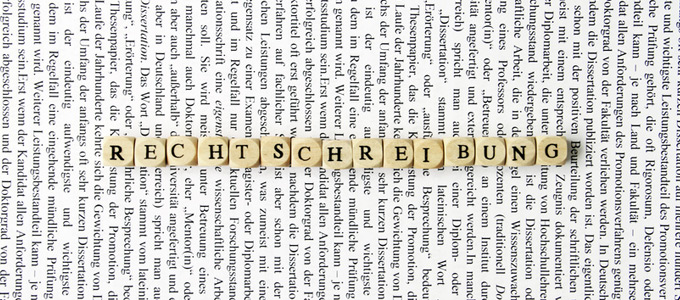Machen Sie Ihren Augen eine Freude – und verschönern Sie jetzt Ihren PC-Desktop: Diese Wallpaper sind kostenlos, schick, ausgefallen, witzig, kunstvoll. In unserer Linkliste findet jeder Geschmack passende Fotografien und Grafiken, die den Blick auf den eigenen Büro-Bildschirm verändern werden. Sie wissen nicht, wie sich der Desktophintergrund Ihres PCs ändern lässt? Ganz einfach: Laden SieContinue reading Wunderschöne Wallpaper: Diese Designs machen Ihren PC-Desktop richtig schick
Aufstieg ohne Fettnäpfchen − so vermeiden Sie Karrierefehler
Auf dem Weg an die berufliche Spitze lauern viele Widrigkeiten. Oft werden Karrierefortschritte gar nicht von Vorgesetzten torpediert, sondern durch eigene Fehler. Manchmal ohne diese überhaupt zu bemerken. Wer sich solche typischen Karrierefehler bewusst macht, kann sich regelmäßig kritisch hinterfragen und ein mögliches Karrieretief aus eigenem Antrieb hinter sich lassen oder sogar ganz vermeiden. Continue reading Aufstieg ohne Fettnäpfchen − so vermeiden Sie Karrierefehler →
Chat-Slang (Teil 1): ASAP, IMHO, ROFL, LOL – was gängiger Chat-Slang bedeutet
Was meint Ihr Chat-Partner bloß, wenn er Sie als „DAU“ bezeichnet? In E-Mails und Foren, auf Facebook und WhatsApp werden umgangssprachliche Ausdrücke oft abgekürzt. Hier haben wir eine Liste mit gängigen Akronymen in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt. Für alle, die Chat-Slang verstehen wollen. Verbreitete Chat-Abkürzungen und was sie bedeuten 2F4U – steht für „To fastContinue reading Chat-Slang (Teil 1): ASAP, IMHO, ROFL, LOL – was gängiger Chat-Slang bedeutet →
Mehr wollen, mehr bekommen: die erfolgreiche Gehaltsverhandlung
Über Geld spricht man nicht? Sollten Sie aber – zumindest wenn es um Ihr Gehalt geht. Der günstigste Zeitpunkt, um über eine Gehalterserhöhung zu verhandeln, ist entweder nach erfolgreichem Abschluss eines Projekts oder bei einem turnusmäßig anstehenden Feedbackgespräch. Dabei geht es nicht darum, um ein Almosen zu bitten, sondern Ihre Ansprüche selbstbewusst und professionell anzumelden.Continue reading Mehr wollen, mehr bekommen: die erfolgreiche Gehaltsverhandlung →
Silvestergrüße: 20 geistreiche SMS- und WhatsApp-Sprüche für die Silvesternacht
Welche Silvestergrüße senden Sie per SMS oder WhatsApp an Ihre Freunde, Verwandten, Arbeitskollegen und Geschäftspartner? Falls Sie noch nach inspirierenden Glückwünschen und Gedanken zum Neujahr suchen, finden Sie hier ganz sicher etwas. Und los geht’s – Silvestergrüße von Wilhelm Busch, Albert Einstein, Goethe, Oliver Kalkofe und vielen mehr… „Wenn’s alte Jahr erfolgreich war,Continue reading Silvestergrüße: 20 geistreiche SMS- und WhatsApp-Sprüche für die Silvesternacht →
Ziele setzen, aber richtig
Wer erfolgreich ist, hat sich in der Regel Ziele gesetzt und aktiv darauf hingearbeitet, diese zu verwirklichen. Ob beruflich oder im Privaten: Ziele sind für eine erfolgreiche Lebensgestaltung immens wichtig, denn sie helfen dabei, Fortschritte zu sehen und sich auf das Machbare und Wesentliche zu konzentrieren. Sie sollen ermutigen und sich deshalb an den eigenenContinue reading Ziele setzen, aber richtig →
Excel-Tabelle in Word einfügen und verknüpfen – so geht’s ruckzuck
Word und Excel stammen beide aus der Microsoft-Softwareschmiede – die Folge: Die beiden mächtigen Office-Tools sind darauf programmiert, miteinander zu kooperieren. Inhalte aus der Tabellenkalkulation lassen sich problemlos in die Textverarbeitung integrieren – und automatisiert synchronisieren. Hier eine Anleitung, wie Sie eine Excel-Tabelle nach Word kopieren. Excel-Tabelle in Word einfügen – markieren, kopieren, einfügen,Continue reading Excel-Tabelle in Word einfügen und verknüpfen – so geht’s ruckzuck →
Geschenke, Geschenke: Nette Geste oder Bestechung unter dem Weihnachtsbaum?
Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – auch bei Geschäftspartnern. Aber Vorsicht, die Betonung liegt auf „kleine“. Präsente für Geschäftspartner und Kunden gehören in vielen Unternehmen zum Vorweihnachtsalltag. Das klingt harmlos, ist aber nicht unkritisch, denn sowohl der Beschenkte als auch der Absender können dadurch in eine missliche Lage geraten. Denn die Grenze zwischen einer nettenContinue reading Geschenke, Geschenke: Nette Geste oder Bestechung unter dem Weihnachtsbaum? →
Apples iPad Pro vs. Microsofts Surface Pro 4 – welcher Notebook-Ersatz ist besser?
Zwei neue 12-Zoll-Edel-Tablets mit Notebook-Funktion sorgen für Furore: Das iPad Pro von Apple und das Surface Pro 4 von Microsoft sind erschienen – und beide wenden sich vor allem an Business-Nutzer. Was sind die Unterschiede? Ein Fakten-Check. Bildschirm – wer löst höher auf? Was die pure Datenlage angeht, ähneln sich die Displays von iPadContinue reading Apples iPad Pro vs. Microsofts Surface Pro 4 – welcher Notebook-Ersatz ist besser? →
Microsoft Office kaufen oder abonnieren – was lohnt sich für Selbstständige?
Wer als Freelancer oder Heimarbeiter Microsofts neues Office 2016 nutzen möchte, hat die Qual der Wahl: Sollte man die Büro-Software einmalig kaufen oder per Abo-Paket Office 365 mieten? Hier die Unterschiede im Überblick. Die Kaufversion: Was kann Office Home & Business 2016? Viele Anwender, die beruflich und privat mit Büroprogrammen arbeiten, erwägen den KaufContinue reading Microsoft Office kaufen oder abonnieren – was lohnt sich für Selbstständige? →
6 Kniffe für stilvolle Weihnachtsgrüße an Geschäftspartner
Weihnachtskarten oder E-Mails? Handschriftlich unterschreiben oder Unterschrift ausdrucken? Hier ein paar Tipps und Anregungen, wie Sie Auftraggebern und Business-Partnern stilvolle und vor allem authentische Weihnachtsgrüße übermitteln. Kniff 1: Gestalten Sie die Weihnachtskarte selbst Ob Kartengruß oder Weihnachtsbrief – individuell gestaltete Weihnachtspost ist der Ausdruck besonderer Wertschätzung. Bei engen, langjährigen und besonders wichtigen Geschäftspartnern lohntContinue reading 6 Kniffe für stilvolle Weihnachtsgrüße an Geschäftspartner →
Podcasting in Unternehmen: Kundenbindung auf die persönliche Art
Seit rund 15 Jahren online verfügbar, sind Podcasts mittlerweile zum Massenmedium geworden. Nicht nur Privatanwender oder Musiker mischen mit, auch für Unternehmen eignen sich Audio- und Videopodcasts vorzüglich zu Marketing- und Werbezwecken, als Kontaktmöglichkeit zu Kunden oder zur internen Kommunikation mit Mitarbeitern. Mit diesen abonnierbaren Mediendateien können auch kleine Firmen, die kein großes Werbebudget haben,Continue reading Podcasting in Unternehmen: Kundenbindung auf die persönliche Art →
Anleitung: Word-Rechtschreibprüfung ausschalten – und wiederherstellen
Die Word Rechtschreibprüfung hilft Microsoft Office-Anwendern, den eigenen Text auf Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik zu überprüfen. Viele Microsoft Office-Nutzer möchten in bestimmten Situationen jedoch die Rechtschreib- und Grammatikprüfung ausschalten, etwa wenn zwei verschiedene Sprachen innerhalb eines Dokuments verwendet werden. Manchmal funktioniert die Rechtschreibprüfung aber auch nicht verlässlich und soll zur Text Kontrolle wiederhergestellt werden. DieseContinue reading Anleitung: Word-Rechtschreibprüfung ausschalten – und wiederherstellen →
Digitale Unterschrift in Outlook, Word und PDF einfügen – so geht‘s
Immer häufiger werden digitale Unterschriften in E-Mails, PDF- oder Word-Dokumenten benötigt. Wie werden sie schnell und professionell erstellt? Und welche Rechtsgültigkeit besitzen sie? Digitale Unterschrift in Outlook erstellen In Microsofts Mail-Programm Outlook lassen sich schnell und komfortabel digitale Unterschriften erstellen. Anschließend kann die professionelle Signatur in E-Mails, Word- oder PDF-Dokumente kopiert werden. So gehenContinue reading Digitale Unterschrift in Outlook, Word und PDF einfügen – so geht‘s →
Umfragen im Handumdrehen: Wie gut kennen Sie Ihre Kunden?
Fragen kostet ja nichts − insbesondere wenn es um Kunden und deren Bedürfnisse geht. Wer sich darauf verlässt, seine Zielgruppe genau zu kennen, riskiert im schlimmsten Fall seine Unternehmens-Existenz. Denn Kunden, deren Bedürfnissen und Wünsche ignoriert werden, wenden sich einem anderen Anbieter zu und sind so schnell nicht wieder einzufangen. Um Käufer besser kennenzulernen, gibtContinue reading Umfragen im Handumdrehen: Wie gut kennen Sie Ihre Kunden? →
Schritt für Schritt: So nutzen Sie Kalender auf PC und Smartphone
Termine eintragen, Teilnehmer einladen, Besprechungen zusagen: All das funktioniert heute reibungslos über die entsprechenden Kalenderfunktionen im elektronischen Terminplaner. Doch viele Arbeitnehmer wechseln vom PC zum Laptop, wenn sie unterwegs sind, oder zum Smartphone, wenn sie in der Besprechung sitzen. Auch auf diesen Geräten sollen alle Termine jederzeit greifbar sein. Termine auf allen Plattformen synchronisierenContinue reading Schritt für Schritt: So nutzen Sie Kalender auf PC und Smartphone →
Wie funktioniert eigentlich ein Toner?
Er ist das Pendant zur Tintenpatrone: Der Toner. Wer einen Laserstrahldrucker zu Hause oder im Büro hat, nutzt ihn meist täglich. Doch wie funktioniert die Toner-Technik eigentlich und wo ist der Unterschied zur Tintenpatrone? Wir haben uns mal näher mit dem Toner beschäftigt. Unterschied zur Tinte Anders als Tintenpatronen enthält die Tonerkartusche keine Flüssigkeit, sondernContinue reading Wie funktioniert eigentlich ein Toner? →
Excel: So fixieren Sie Zeilen und Spalten, um sich das Scrollen zu sparen
Alltäglich schlagen sich weltweit Millionen Büroarbeiter und Studenten mit ellenlangen Excel-Tabellen herum. Schnell verliert man in Microsofts Tabellenkalkulation die Übersicht – vor allem, wenn sich bestimmte Zeilen oder Spalten beim Scrollen nicht mitbewegen. Wie lassen sie sich fixieren, damit sie immer angezeigt werden? Oberste Excel-Zeilen oder -Spalten fixieren Enthält Ihre Tabelle Zeilen mit ÜberschriftenContinue reading Excel: So fixieren Sie Zeilen und Spalten, um sich das Scrollen zu sparen →
Screenshots machen und verschönern – So geht‘s am Windows-Rechner
Screenshots haben viele Vorteile: Durch sie werden Präsentationen anschaulicher, Feedback und Fehlerdokumentationen werden konkreter und Bilder, die sich nicht anders ablegen lassen, können so einfach gespeichert werden. Einen Screenshot zu erstellen ist für Windows-Nutzer kein Hexenwerk – per Tastenkombi oder „Snipping Tool“ ist das Bildschirmfoto schnell erstellt und leicht bearbeitet. Hier ein paar Praxistipps. Continue reading Screenshots machen und verschönern – So geht‘s am Windows-Rechner →
Android, aber sicher! Security Apps für Ihr Smartphone
Googles Android ist das am weitesten verbreitete Mobilbetriebssystem – das macht es zum beliebten Angriffsziel. 1,2 Millionen Schädlinge prasselten 2014 auf Android-Handys und-Smartphones in Deutschland ein, so das Fachmagazin „Computerbild“. Und die Bedrohungslage hat sich nicht gebessert, ein guter Virenschutz ist daher für Smartphones mit Google-OS Pflicht. Doch ein Virenscanner ist nicht die einzige Security-App,Continue reading Android, aber sicher! Security Apps für Ihr Smartphone →