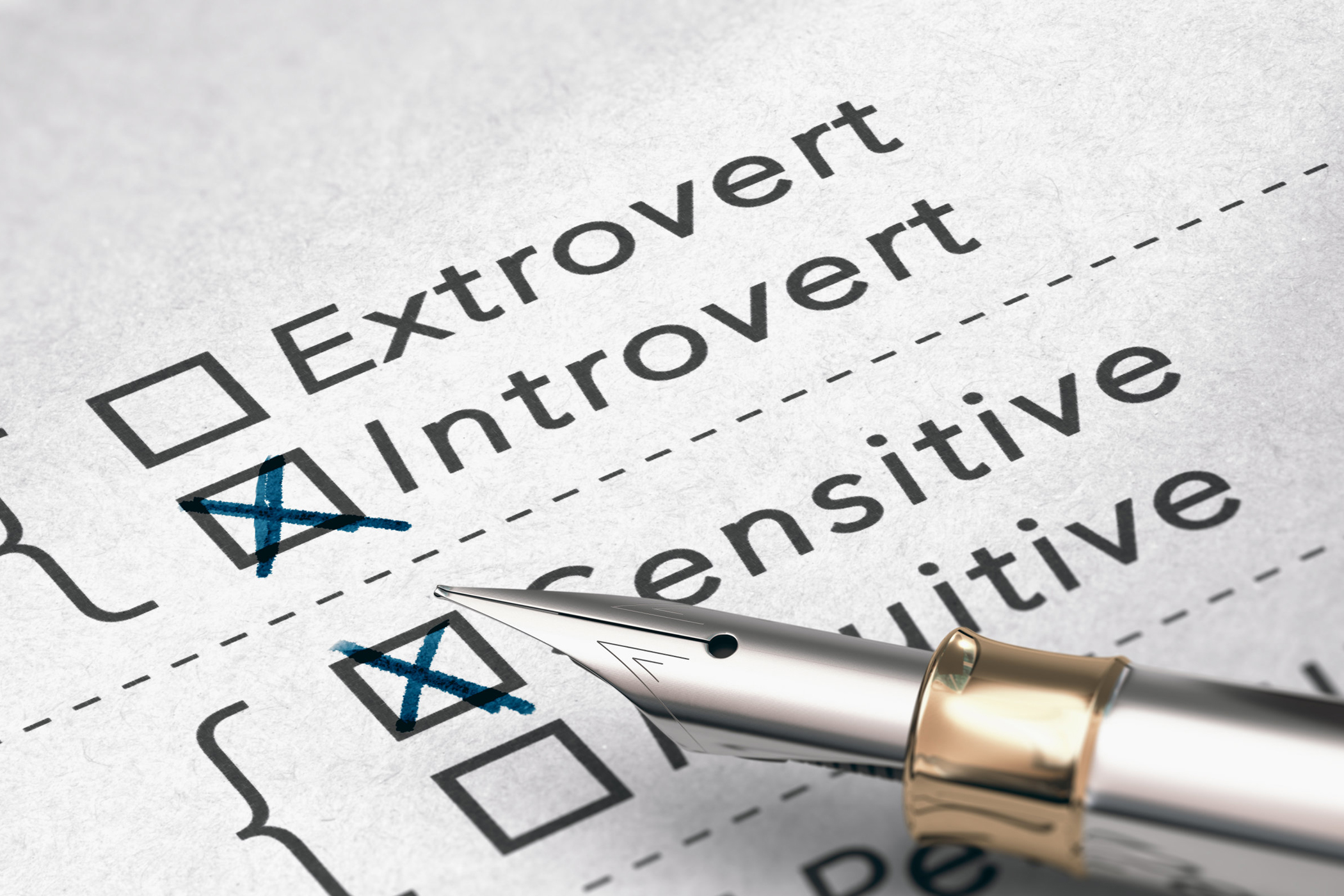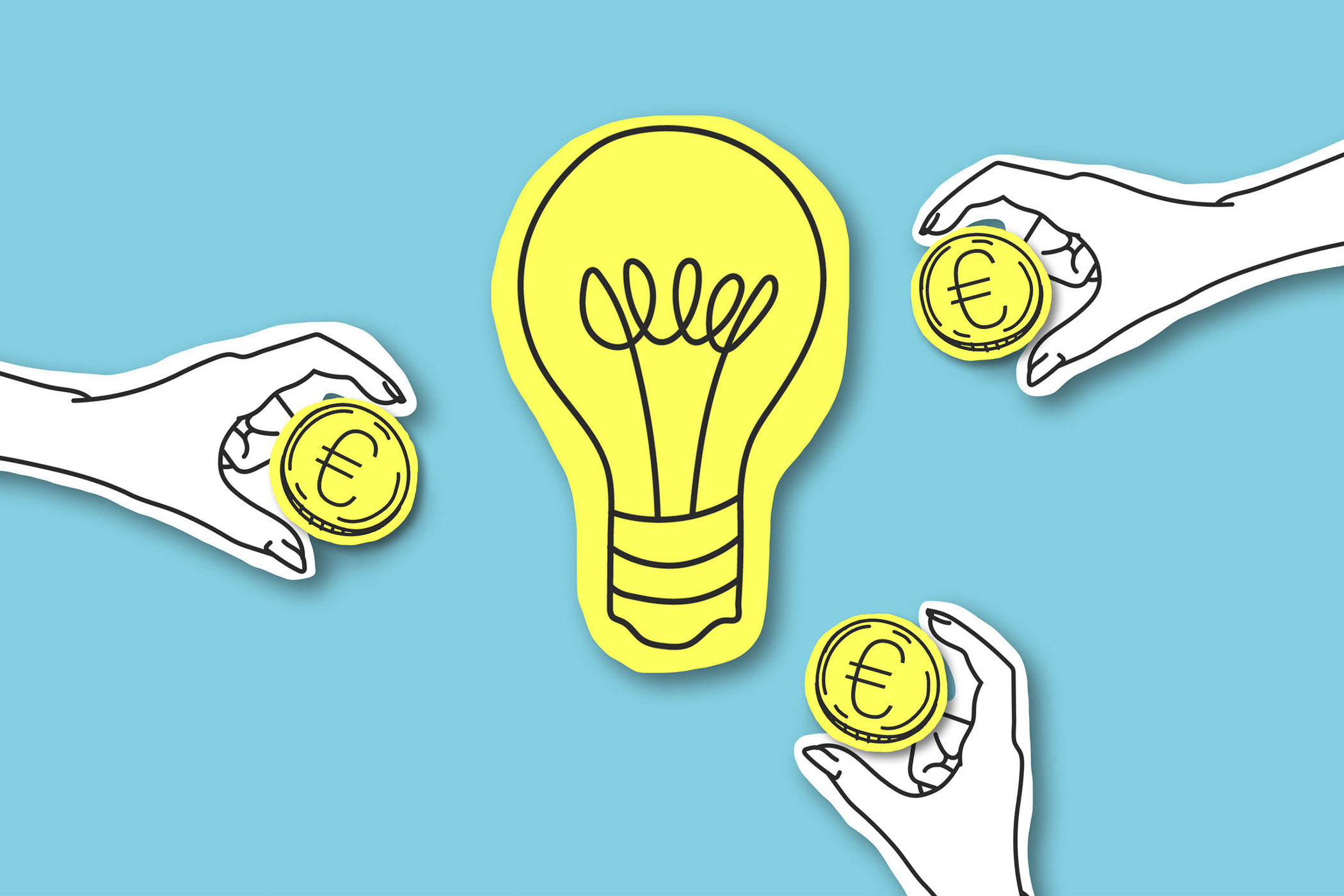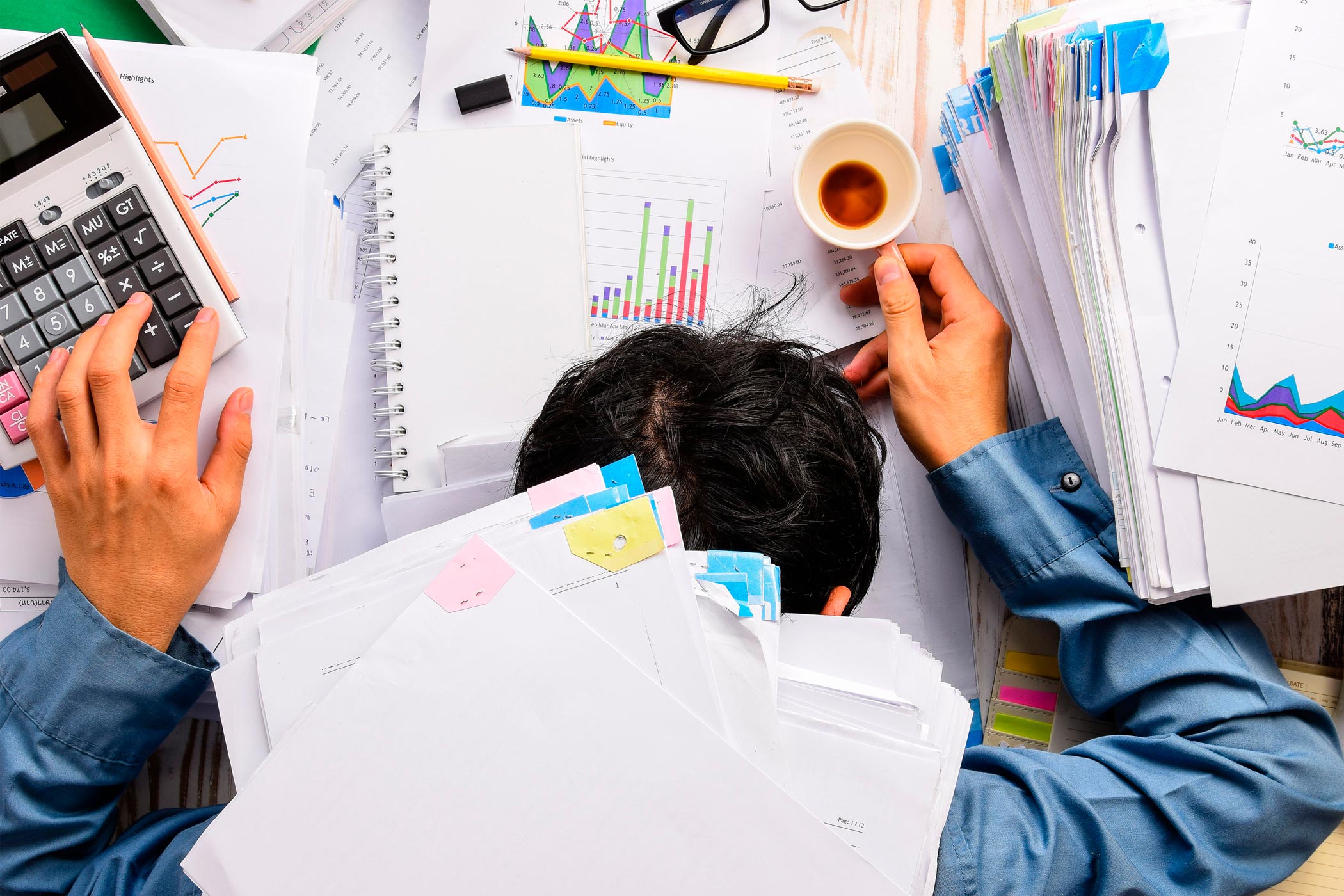„Visitenkarten sind doch diese gedruckten Kärtchen mit Kontaktinformationen … Braucht man die denn in unserer digitalisierten Geschäftswelt überhaupt noch?“
Diese Frage stellen sich viele Unternehmen. Unsere Antwort lautet: „Ja. Aber nur, wenn die Visitenkarte das Zeug dazu hat, dafür zu sorgen, dass man im Gedächtnis bleibt. Nur dann ist sie ein geeignetes Mittel, um persönliche Beziehungen zu Geschäftspartnern oder Kunden zu stärken.“
Selbstbewusst auftreten im Job: 3 Tipps für mehr Selbstsicherheit
Nicht jeder Mensch ist von Natur aus selbstsicher und extrovertiert. Für die Karriere kann ein selbstbewusstes Auftreten jedoch förderlich sein: Es hilft, sich in kniffligen Situationen zu behaupten. Mit folgenden Tipps lässt sich die selbstsichere Ausstrahlung trainieren.
Teamfähigkeit verbessern: Was das bedeutet und wie es gelingt
Bevor man daran geht, die eigene Teamfähigkeit zu verbessern, muss zunächst eine Frage geklärt werden: Was ist mit dem Begriff überhaupt gemeint? Was ist Teamfähigkeit und wie zeigt sie sich im Job? Teamfähige Menschen sind in der Lage, ihre Fähigkeiten in einer Gruppe so einzusetzen, dass das Team den größtmöglichen gemeinsamen Erfolg erreicht. Im BerufslebenContinue reading Teamfähigkeit verbessern: Was das bedeutet und wie es gelingt →
Mini-Retirement: Was ist das, was bringt es und wie gelingt es?
Ausbildung oder Studium, Berufsleben, Rente: Die klassische Abfolge ist heute längst nicht mehr der einzige mögliche Karriereweg. Bewusste Auszeiten werden immer beliebter. Dazu gehört auch das sogenannte Mini-Retirement. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?
Zurück zum alten Arbeitgeber – eine gute Idee?
Viele Arbeitnehmer können sich eine Rückkehr zum alten Arbeitgeber nicht vorstellen. Schließlich gab es gute Gründe für die Trennung: das sprichwörtlich „zerschnittene Tischtuch“, mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten oder unliebsame Kollegen bzw. Vorgesetzte.
Wer solche Gründe nicht hatte oder trotz allem zum ehemaligen Unternehmen zurückkehren möchte, sollte sich den Schritt gut überlegen. Wohl selten kommt es vor, dass ein „Boomerang-Arbeitnehmer“ nach einer längeren Abwesenheit so erfolgreich durchstartet wie Steve Jobs bei Apple.
Persönlichkeitstests im Bewerbungsprozess
Durch Bewerbungsschreiben und Lebenslauf finden Personaler ziemlich schnell heraus, ob ein Bewerber die fachlichen Voraussetzungen erfüllt. Das Vorstellungsgespräch gibt dann Aufschluss darüber, wie es um die sozialen Fähigkeiten des Jobaspiranten steht. Aber ist der Bewerber tatsächlich am besten geeignet für die ausgeschriebene Stelle?
Um diese Frage so gut wie möglich zu beantworten, setzen viele Unternehmen auf Persönlichkeitstests. Schließlich möchte man Fehlbesetzungen unbedingt vermeiden, die zu hohen Kosten führen können.
Mit Fehlentscheidungen richtig umgehen: 5 Tipps
Niemand ist vor einer Fehlentscheidung gefeit. Gerade deshalb ist es im Job besonders wichtig, professionell mit möglichen Folgen umzugehen. Mit diesen Tipps lässt sich das Beste aus der Situation machen.
Häufige Jobwechsel im Lebenslauf: Vor- und Nachteile des Jobhoppings
Wenn sich eine gute Gelegenheit bietet, sollte man diese ergreifen. Demnach ist erst einmal nichts falsch daran, den Job zu wechseln. Zu viel Jobhopping kann bei Personalern jedoch den Eindruck erwecken, dass der betreffende Bewerber sprunghaft oder unzuverlässig ist. Deshalb ist es wichtig, die Jobwechsel gut begründen zu können.
Selbständig machen: Marketing (Artikelserie, Teil 6)
Sich selbständig zu machen, ist ein komplexes Vorhaben. Gut, wenn man den einen oder anderen Tipp bekommt. Genau das machen wir mit unserer Artikelserie und haben uns bereits mit den folgenden Themen auseinandergesetzt: Gründertyp, Geschäftsidee, Rechtsformen, Businessplan und Finanzierung. In den nächsten Absätzen geht es nun um das Marketing. Denn was nützt die beste Geschäftsidee, wenn niemand davon weiß!?
Selbständig machen: Finanzierung, Förderungen und Gründerwettbewerbe (Artikelserie, Teil 5)
In unserer umfangreichen Artikelserie haben wir uns bereits mit dem Gründertyp, der Geschäftsidee, der Rechtsform und dem Businessplan beschäftigt. In diesem Beitrag geht es nun um die wichtige Frage: Wie kann man den Start in die Selbständigkeit am besten finanzieren?
Nur in seltenen Fällen haben Existenzgründer genügend Eigenkapital „auf der hohen Kante“. Alle anderen sind auf Fremdkapital und/oder Fördergelder angewiesen. Da man dieses auf vielen Wegen beschaffen kann, kratzen wir in unserem Artikel an der Oberfläche und blicken nur hier und dort genauer hin.
Auch mit der erfolgreichen Teilnahme an Existenzgründerwettbewerben kann man das Startkapital aufstocken. Daher haben wir das Thema mit aufgenommen.
Körpersprache: So punkten Bewerber im Vorstellungsgespräch
In einem Vorstellungsgespräch präsentieren Bewerber sich selbst. Dabei kommt es nicht nur darauf an, was sie sagen, sondern auch, wie sie das Gesagte rüberbringen. Mimik, Gestik und Körperhaltung vermitteln Recruitern und Personalchefs einen ersten Eindruck von der Persönlichkeit des Bewerbers. Wer weiß, worauf er achten muss, kann seine eigene Körpersprache somit gezielt einsetzen, um sich selbst in das bestmögliche Licht zu rücken.
Gehaltsgespräch: 8 Dinge, die Angestellte auf keinen Fall sagen sollten
Es steht ein Gehaltsgespräch an? Das ist für viele Arbeitnehmer eine aufregende Situation. Doch wer sich richtig vorbereitet, kann dem Termin mit dem Chef gelassen entgegensehen. Neben einem gesunden Selbstbewusstsein hilft es, wenn die folgenden Aussprüche absolut tabu sind.
Selbständig machen: Der Businessplan (Artikelserie, Teil 4)
Nachdem wir in den ersten drei Artikeln einen Blick auf den Gründertyp, die Geschäftsidee und die Rechtsform geworfen haben, widmen wir uns nun dem Businessplan. Dieser ist vor allem in der Frühphase der Gründung von immenser Bedeutung.
Im Businessplan wird die Geschäftsidee formuliert und das Konzept detailliert beschrieben. Somit dient er dem Gründer selbst als Wegweiser und einem möglichen Geldgeber als Basis für seine Überlegungen.
Selbständig machen: Rechtsform des Unternehmens (Artikelserie, Teil 3)
Wer ein Gründertyp ist und die passende Geschäftsidee gefunden hat, muss sich im nächsten Schritt darüber Gedanken, welche Rechtsform er wählt. Diese Entscheidung ist sehr wichtig, da die Rechtsform den formalen und rechtlichen Rahmen des Unternehmens vorgibt. Im folgenden Artikel skizzieren wir die gängigsten Rechtsformen in Deutschland und nennen die jeweiligen Vorteile und Nachteile.
Jobangebot: Erfolgreicher Verhandeln mit diesen Tipps
Künftiger Aufgabenbereich, wöchentliche Arbeitszeit, Wunschgehalt: Schon während des Bewerbungsprozesses kommen erste Vertragsdetails zur ausgeschriebenen Stelle zur Sprache. Doch erst wenn das Jobangebot auf dem Tisch liegt, geht es an die konkreten Verhandlungen für den Arbeitsvertrag. Mit ein paar Tipps holen Bewerber das meiste für sich heraus.
Den Chef lenken: Mit diesen 5 Tipps klappt es
Ganz klar: Der direkte Vorgesetzte hat das letzte Wort. Doch manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, wenn Angestellte ihrem Chef bei der Entscheidungsfindung subtil etwas unter die Arme greifen. Cheffing, also die Führung von unten, kann dazu beitragen, die Führungsarbeit insgesamt zu verbessern – was am Ende nicht nur dem Ergebnis, sondern auch den Arbeitsbedingungen zugutekommt.
Umschulung: Was es zur beruflichen Weiterbildung zu wissen gibt
Eine Umschulung ist eine Form der Aus- oder Weiterbildung. Durch sie qualifiziert sich eine Person, die bereits einen Beruf erlernt hat, für einen Job in einem anderen Berufsfeld. Eine berufliche Neuorientierung kann die unterschiedlichsten Gründe haben.
Branche wechseln: In diesen drei Fällen lohnt sich die Umorientierung
Wer nicht mehr mit seinem Job glücklich ist oder schlicht keine passende Stelle in seinem Berufsfeld findet, steht früher oder später vor der Frage: “Sollte ich die Branche wechseln?” Keine leichte Entscheidung. Schließlich müssen Quereinsteiger sich oft völlig neues Wissen aneignen, vielleicht sogar eine zusätzliche Ausbildung absolvieren.
In den folgenden Fällen kann sich dieser Aufwand jedoch durchaus bezahlt machen.
Arbeitstermin absagen oder verschieben: So macht man es richtig
Manchmal lässt es sich nicht vermeiden: Man muss einen längst vereinbarten Termin absagen oder auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Um Kollegen, Geschäftspartner oder Kunden nicht zu verärgern, sollte man dabei jedoch mit viel Feingefühl vorgehen.
Überstunden: Die wichtigsten Infos zum Thema Mehrarbeit
Im Normalfall dürfen Angestellte nicht mehr als acht Stunden pro Werktag arbeiten. So ist es im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) festgelegt. Als Werktage zählen dabei nicht nur Montag bis Freitag, sondern auch der Samstag. Daraus ergibt sich eine maximale Regelarbeitszeit von 48 Stunden pro Woche. Wie viele Wochenstunden ein Arbeitnehmer am Ende genau leisten muss, ist jedoch im jeweiligen Arbeitsvertrag festgelegt.