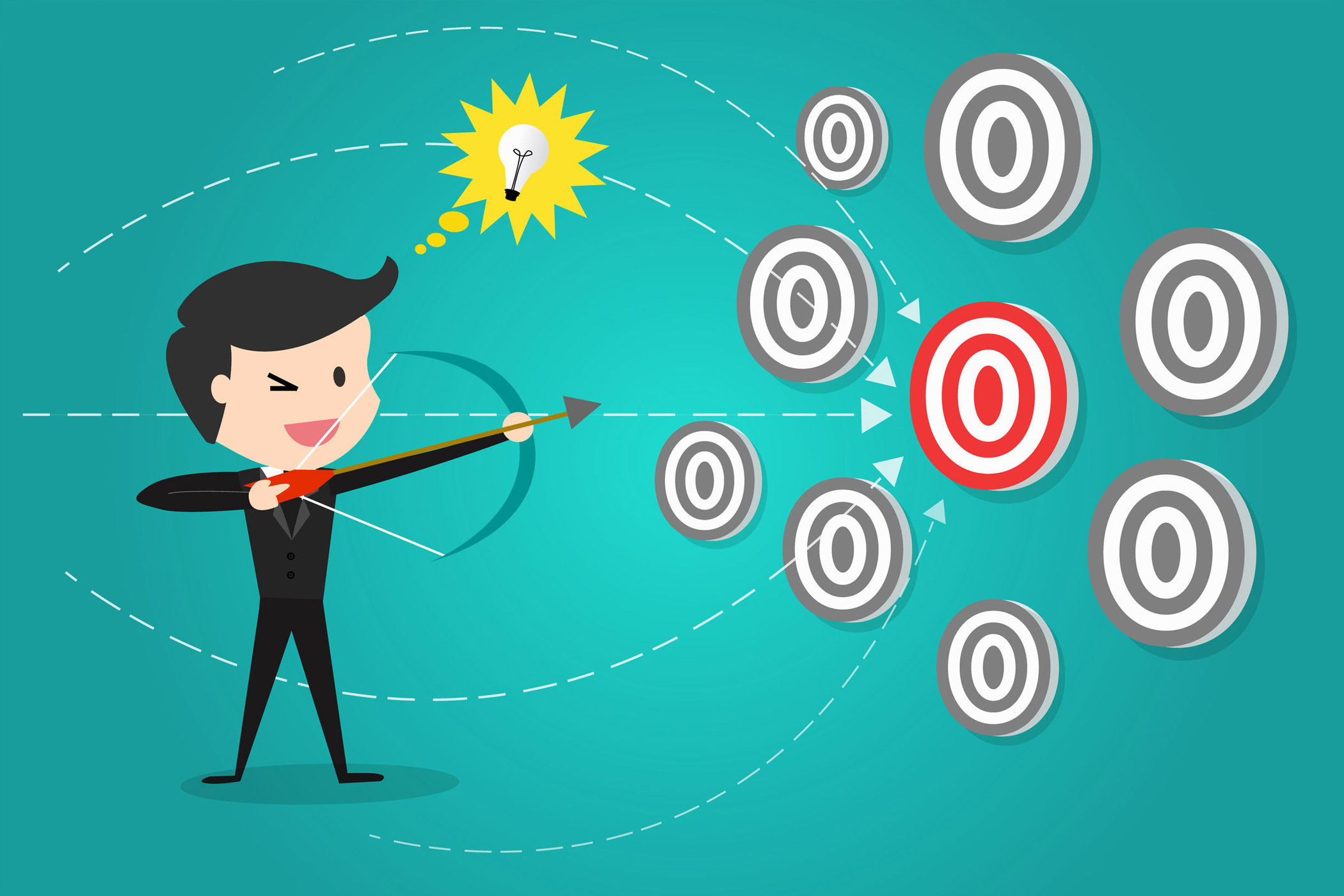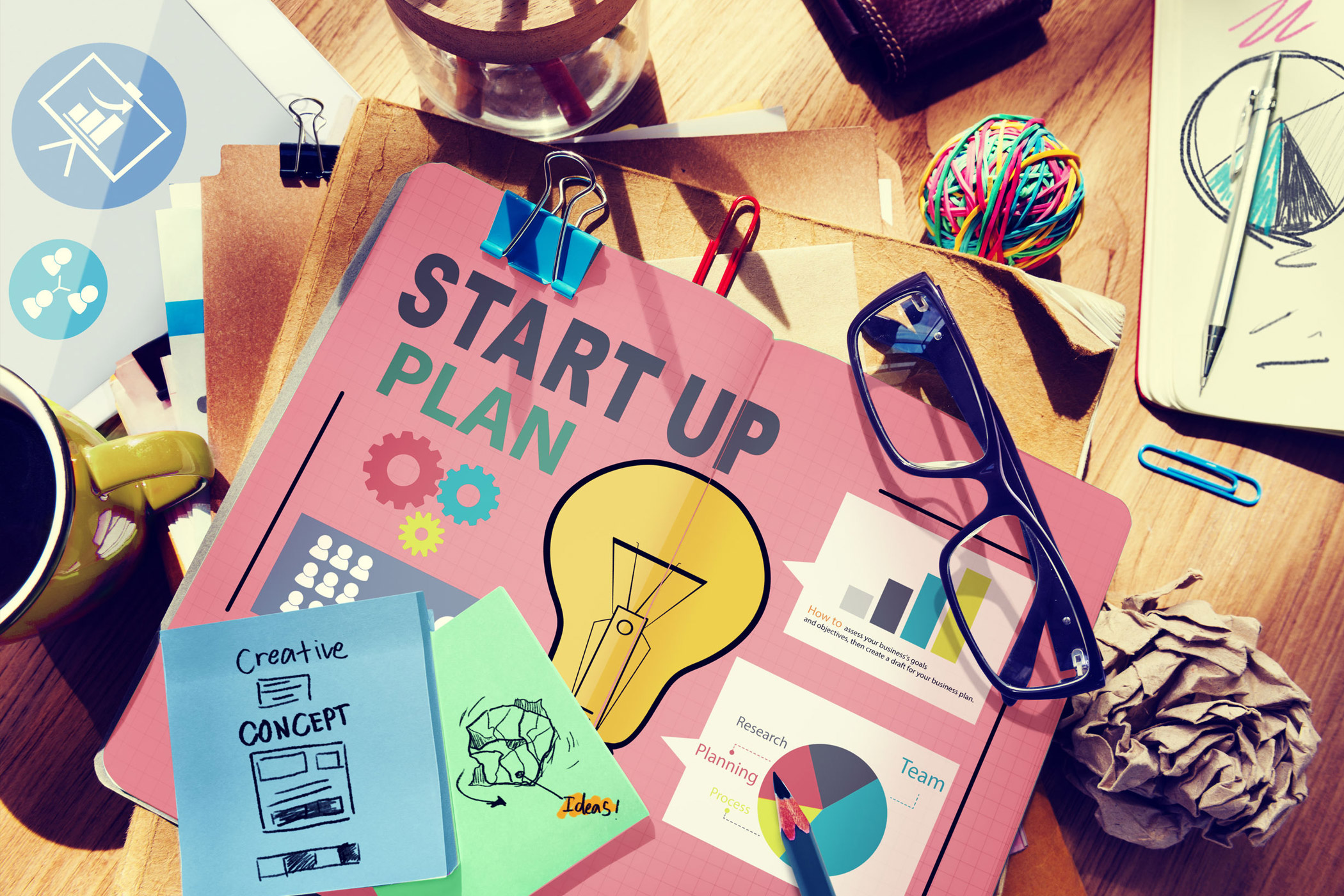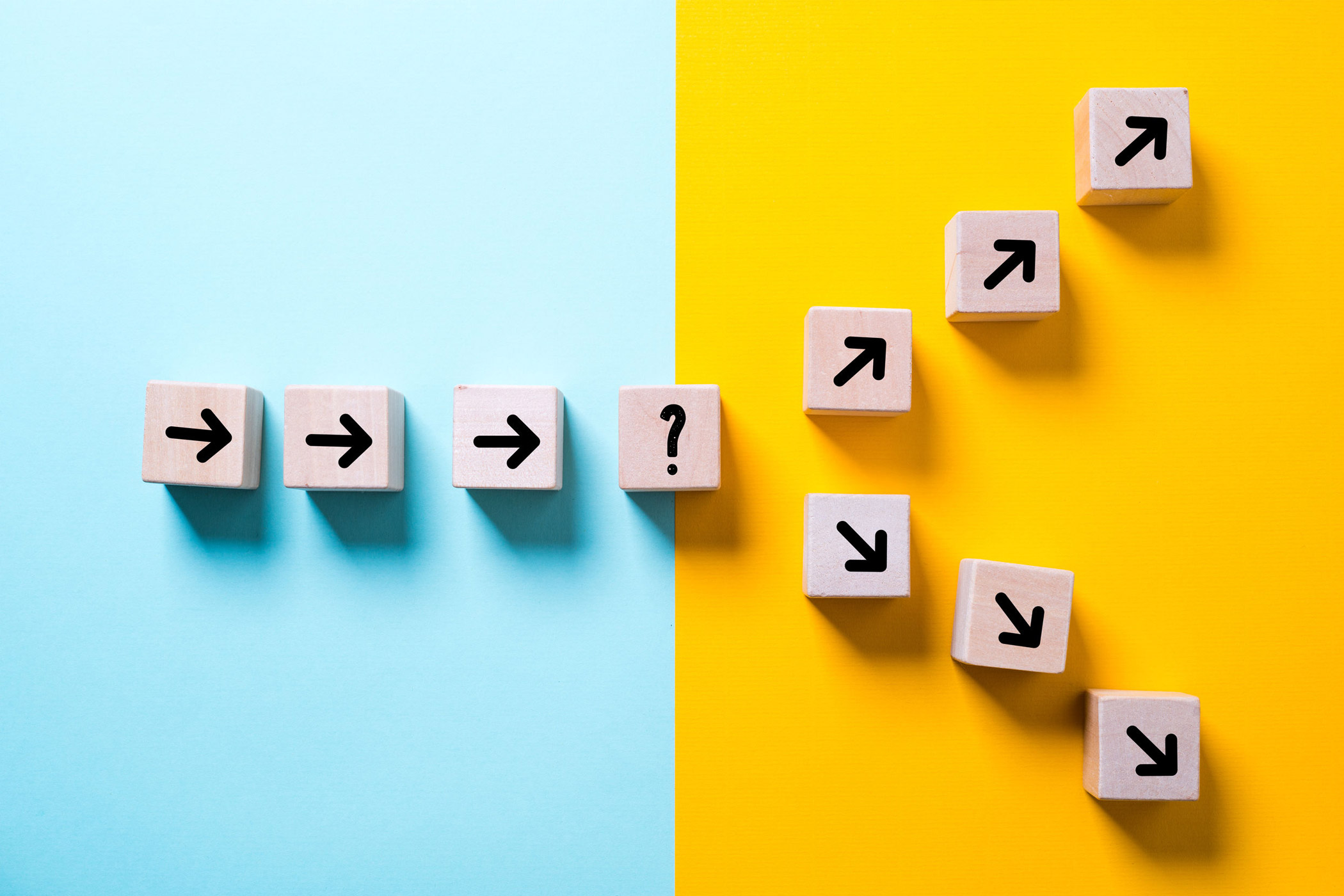Es steht ein Gehaltsgespräch an? Das ist für viele Arbeitnehmer eine aufregende Situation. Doch wer sich richtig vorbereitet, kann dem Termin mit dem Chef gelassen entgegensehen. Neben einem gesunden Selbstbewusstsein hilft es, wenn die folgenden Aussprüche absolut tabu sind.
Selbständig machen: Der Businessplan (Artikelserie, Teil 4)
Nachdem wir in den ersten drei Artikeln einen Blick auf den Gründertyp, die Geschäftsidee und die Rechtsform geworfen haben, widmen wir uns nun dem Businessplan. Dieser ist vor allem in der Frühphase der Gründung von immenser Bedeutung.
Im Businessplan wird die Geschäftsidee formuliert und das Konzept detailliert beschrieben. Somit dient er dem Gründer selbst als Wegweiser und einem möglichen Geldgeber als Basis für seine Überlegungen.
Selbständig machen: Rechtsform des Unternehmens (Artikelserie, Teil 3)
Wer ein Gründertyp ist und die passende Geschäftsidee gefunden hat, muss sich im nächsten Schritt darüber Gedanken, welche Rechtsform er wählt. Diese Entscheidung ist sehr wichtig, da die Rechtsform den formalen und rechtlichen Rahmen des Unternehmens vorgibt. Im folgenden Artikel skizzieren wir die gängigsten Rechtsformen in Deutschland und nennen die jeweiligen Vorteile und Nachteile.
Fit fürs Vorstellungsgespräch: Eigene Stärken und Schwächen kennen und richtig formulieren
Jeder Mensch ist anders, hat eigene Stärken und Schwächen – doch nicht jeder ist sich derer auch konkret bewusst. Spätestens beim Vorstellungsgespräch sind Bewerber jedoch meist gezwungen, ihre persönlichen Stärken und Schwächen zu kommunizieren. Dabei helfen ein wenig Vorbereitung und die folgenden Tipps.
Jobangebot: Erfolgreicher Verhandeln mit diesen Tipps
Künftiger Aufgabenbereich, wöchentliche Arbeitszeit, Wunschgehalt: Schon während des Bewerbungsprozesses kommen erste Vertragsdetails zur ausgeschriebenen Stelle zur Sprache. Doch erst wenn das Jobangebot auf dem Tisch liegt, geht es an die konkreten Verhandlungen für den Arbeitsvertrag. Mit ein paar Tipps holen Bewerber das meiste für sich heraus.
Bewerbungsgespräch: 5 Tipps von Models für gelungenes Auftreten
Der erste Eindruck zählt: Das gilt im Alltag genauso wie im Bewerbungsgespräch. Wer auf der Suche nach einem neuen Job ist, kann sich hier eine Scheibe von professionellen Models abschneiden. Wie andere Arbeitnehmer im Vorstellungsgespräch, müssen sie bei Castings auf den ersten Blick überzeugen. Da ist gekonntes Auftreten gefragt.
Umschulung: Was es zur beruflichen Weiterbildung zu wissen gibt
Eine Umschulung ist eine Form der Aus- oder Weiterbildung. Durch sie qualifiziert sich eine Person, die bereits einen Beruf erlernt hat, für einen Job in einem anderen Berufsfeld. Eine berufliche Neuorientierung kann die unterschiedlichsten Gründe haben.
Branche wechseln: In diesen drei Fällen lohnt sich die Umorientierung
Wer nicht mehr mit seinem Job glücklich ist oder schlicht keine passende Stelle in seinem Berufsfeld findet, steht früher oder später vor der Frage: “Sollte ich die Branche wechseln?” Keine leichte Entscheidung. Schließlich müssen Quereinsteiger sich oft völlig neues Wissen aneignen, vielleicht sogar eine zusätzliche Ausbildung absolvieren.
In den folgenden Fällen kann sich dieser Aufwand jedoch durchaus bezahlt machen.
Selbständig machen: Die Geschäftsidee (Artikelserie, Teil 2)
Im ersten Teil unserer mehrteiligen Artikelserie haben wir uns damit beschäftigt, woran man erkennen kann, dass man sich als Unternehmer eignet. Wer die Frage „Bin ich ein Gründertyp?“ mit einem klaren „Ja“ beantworten kann, muss sich im nächsten Schritt mit einem Thema befassen, das maßgeblich für den Erfolg der Selbständigkeit ist: die Geschäftsidee.
In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie man die richtige Geschäftsidee findet und darauf basierend entsprechende Ziele formuliert. Darüber hinaus stellen wir fünf spannende und Erfolg versprechende Geschäftsideen vor.
Richtig kündigen: Mit diesen 5 Tipps klappt’s
Es steht ein Berufswechsel an, die Kündigung beim alten Job jedoch noch bevor? Viele Arbeitnehmer machen sich Gedanken, wie sie ihren Arbeitgeber am besten von ihrem Beschluss in Kenntnis setzen. Die folgenden fünf Tipps helfen, professionell mit der Situation umzugehen.
Neues Wissen schneller umsetzen: So gelingt es
Fachzeitschriften, Seminare und Workshops sollen neue Denkanstöße geben und Arbeitnehmer und -geber gleichermaßen fachlich weiterbilden. Doch das beste Fachwissen bringt nichts, wenn es nicht auch in die Tat umgesetzt wird. In der Praxis gerät neu Gelerntes schnell in Vergessenheit, wird schlicht als “nicht umsetzbar” abgetan oder scheitert an der mangelnden Motivation, dauerhaft etwas zu verändern. Das muss nicht sein.
Selbständig machen: Bin ich ein Gründertyp? (Artikelserie, Teil 1)
In den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema Existenzgründung. Sich selbständig zu machen, ist ein Traum von vielen Menschen. Damit dieser Traum jedoch in Erfüllung gehen kann und nicht im Chaos endet, bedarf es guter Vorbereitung.
Mit unseren Informationen möchten wir die Planungen erleichtern und eine umfangreiche Basis für die Entscheidungsfindung bieten. Dass wir dabei nicht alles rosarot malen, zeigt bereits die Frage, mit der wir uns gleich zu Beginn der Artikelserie beschäftigen.
Kündigung während der Probezeit: Das sollten Arbeitnehmer beachten
Die erste Zeit im neuen Job dient Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum gegenseitigen “beschnuppern”. In der Probezeit wird meist schnell klar, ob Vorstellungen und Arbeitsalltag zusammenpassen. Ist das nicht der Fall, kann das Arbeitsverhältnis relativ kurzfristig beendet werden. Und zwar von beiden Seiten. Doch woran erkennt man, dass der Job nicht passt und was sollte man bei einer Kündigung während der Probezeit beachten?
So klappt’s: 5 Tipps für die ersten 100 Tage im neuen Job
Der Arbeitsvertrag ist unterschrieben, die neue Stelle im Wunschunternehmen gesichert. Neben viel Freude ist der Jobwechsel allerdings oft auch mit viel Aufregung verbunden. Denn jetzt heißt es erstmal, sich im neuen Job zu beweisen. Um diese Herausforderungen spielend zu meistern, sollte man in den ersten Monaten einfach folgende fünf Tipps beherzigen:
Karriere machen ohne Führungsverantwortung: So geht’s
Karriere machen, bedeutete bis dato den Aufstieg in eine Führungsposition mit Personalverantwortung. Doch mittlerweile wollen viele Arbeitnehmer lieber ohne Chefposten die Möglichkeit haben, sich beruflich weiterzuentwickeln und aufzusteigen. Auch die Unternehmen haben das erkannt und bieten ihren Mitarbeitern oft zusätzlich andere Wege, Karriere zu machen. Eine Alternative kann unter anderem die sogenannte Fachkarriere sein.
Aufhebungsvertrag: Die wichtigsten Tipps zur vorzeitigen Trennung
Anders als bei einer klassischen Kündigung wird das Arbeitsverhältnis bei einem Aufhebungsvertrag nicht einseitig beendet. Stattdessen einigen sich beide Seiten auf die vorzeitige Trennung. Doch wo liegen die Vorteile, wo die Nachteile bei einem Aufhebungsvertrag? Und vor allem: Was gilt es zu beachten?
Onboarding – So klappt die Integration neuer MitarbeiterInnen
Damit sich neue Mitarbeiter auf Anhieb im Unternehmen wohl fühlen und möglichst schnell produktiv sein können, sollte der Eingliederungsprozess gut durchdacht sein. Das sogenannte Onboarding ist eine Strategie, die dabei helfen kann. In unserem Artikel beschäftigen wir uns mit den folgenden Fragen: Was versteht man genau unter Onboarding? Wer sollte am Onboarding beteiligt sein? Welche Vorteile erhofft man sich?
Bewerbungsgespräch im Winter: Richtig anziehen fürs Jobinterview
Wenn die Temperaturen im Winter gen Null tendieren oder sogar darunter liegen, ist die Zeit für warme Kuschelpullover und dicke Stiefel gekommen. Doch fürs Bewerbungsgespräch ist dieser Look eher ungeeignet. Zum Glück gibt es einige Tipps, mit denen Bewerber angemessen schick und trotzdem nicht völlig durchgefroren zum Job-Interview erscheinen können.
Es muss nicht immer Geld sein: 5 beliebte Alternativen zur Gehaltserhöhung
Regelmäßige Gehaltserhöhungen tragen maßgeblich dazu bei, die Motivation der Angestellten aufrecht zu erhalten. Doch nicht jedes Unternehmen kann oder will das Gehalt seiner Mitarbeiter so oft und in dem Maße anheben, wie diese das gerne hätten. Dann können steuer- und sozialabgabenfreie Extras eine echte Alternative sein.
Sisu: Schwierigkeiten meistern auf Finnisch
Sisu ist untrennbar mit der finnischen Lebensart verbunden. Das Konzept ist eine Mischung aus Mentalität und Philosophie und soll helfen, schwierige Zeiten gut zu überstehen. Wir verraten, was sich hinter Sisu verbirgt und wie sich das Konzept nutzen lässt.