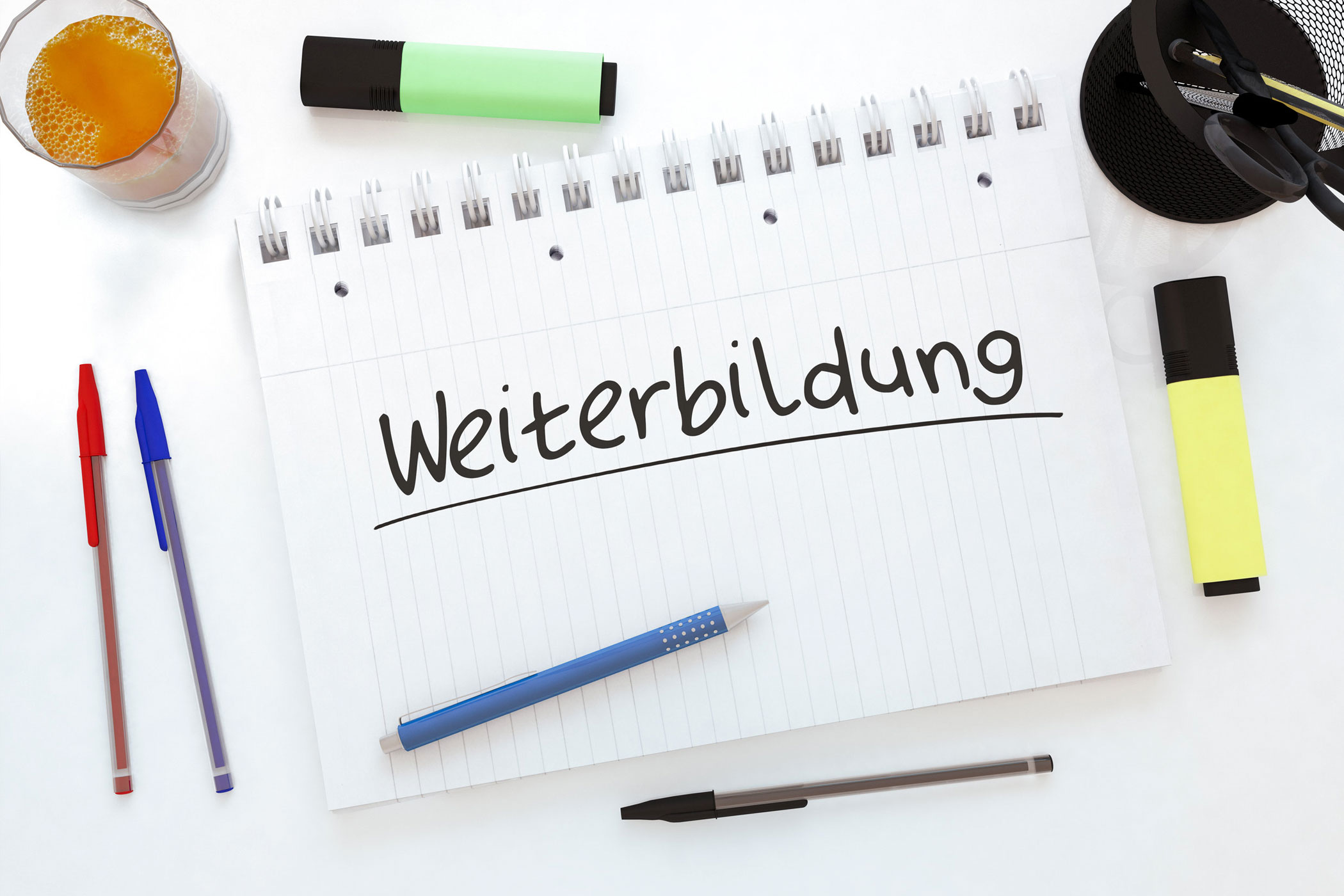Sei es im Bewerbungsgespräch, bei einem wichtigen Geschäftstreffen in großer Runde oder zu einem anderen Anlass: In vielen Situationen ist es wichtig, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. So werden Entscheidungsträger aufmerksam, was dabei helfen kann, die Chancen auf berufliche Weiterentwicklung, neue Aufgaben oder Jobs zu verbessern. Die folgenden Tipps helfen, aus der Masse hervorzustechen. 1.Continue reading In Erinnerung bleiben: 5 Tipps, um beim Gegenüber einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen
Kundenbindung steigern: Tipps, um aus Neukunden Stammkunden zu machen
Durch den rasant wachsenden Onlinehandel sind Kunden heutzutage nicht mehr auf einzelne Anbieter angewiesen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine hohe Kundenbindung für Unternehmen wichtig. Die Grundlage hierfür ist wiederum eine hohe Kundenzufriedenheit: Je besser die Erwartungen des Kunden erfüllt wurden und je positiver das Erlebnis mit der Marke ausfällt, desto geringer ist seine Bereitschaft,Continue reading Kundenbindung steigern: Tipps, um aus Neukunden Stammkunden zu machen →
Digital Leadership: Was zeichnet den Führungsstil eines Digital Leader aus?
Die Digitalisierung hat das Arbeitsleben nachhaltig verändert: Konsumenten und somit Unternehmen agieren globaler und zahlreiche Start-ups mischen mit. Damit steigt für viele Unternehmen der Druck, stets innovativ und kreativ zu sein, um konkurrenzfähig zu bleiben. Zudem steigt auch der Wettbewerb um gut ausgebildete Fachkräfte. Das führt dazu, dass potenzielle Arbeitnehmer öfter den Job wechseln. UmContinue reading Digital Leadership: Was zeichnet den Führungsstil eines Digital Leader aus? →
Unbezahlter Urlaub: Wissenswertes rund um Anspruch, Dauer und Versicherung
Jedem Arbeitnehmer steht bezahlter Jahresurlaub zu – aber wie sieht es mit unbezahltem Urlaub aus? Gibt es einen Anspruch auf Freistellung durch den Arbeitgeber? Und was muss dabei beachtet werden? Das Wichtigste im Überblick. Was versteht man unter unbezahltem Urlaub? Bei unbezahltem Urlaub handelt es sich um eine Form der Freistellung: Arbeitnehmer müssen in dieserContinue reading Unbezahlter Urlaub: Wissenswertes rund um Anspruch, Dauer und Versicherung →
Mitarbeiter ständig krank: Wie Arbeitgeber das Fehlzeitengespräch richtig führen
Ein Mitarbeiter des Teams ist im Vergleich zu seinen Kollegen besonders häufig krank? Dann besteht Gesprächsbedarf. Denn: Die häufigen Fehlzeiten können die Planung durcheinanderbringen und für Mehrarbeit und damit schlechte Stimmung bei den Kollegen sorgen. Was der Arbeitgeber fragen darf und was tabu bleiben muss, dazu mehr hier. Ganz wichtig: Im Gespräch sachlich bleiben GenerellContinue reading Mitarbeiter ständig krank: Wie Arbeitgeber das Fehlzeitengespräch richtig führen →
Unternehmenswerte: Ihre Bedeutung und Tipps zur Formulierung
Sowohl kleine, mittlere als auch große Firmen sollten sich die Zeit nehmen, ihre Unternehmenswerte zu bestimmen und diese festzuhalten. Der Grund: Sogenannte “Core Values” haben in mehrfacher Hinsicht einen positiven Effekt auf den Unternehmenserfolg – sofern sie richtig formuliert werden. Darum ist es sinnvoll, Unternehmenswerte zu formulieren Für welche Werte steht ein Unternehmen – innerhalbContinue reading Unternehmenswerte: Ihre Bedeutung und Tipps zur Formulierung →
Online-Vorstellungsgespräch: Vor- und Nachteile sowie Tipps für den Ersteindruck per Videochat
Eine Einladung zu einem Online-Vorstellungsgespräch ist inzwischen fast genauso üblich wie ein erstes Treffen von Angesicht zu Angesicht. Doch das Gespräch per Videochat stellt Bewerber vor neue Herausforderungen. Mehr zu Vor- und Nachteilen der Bewerbungsform sowie Tipps für das Online-Vorstellungsgespräch, gibt es hier.Continue reading Online-Vorstellungsgespräch: Vor- und Nachteile sowie Tipps für den Ersteindruck per Videochat →
Active Sourcing: Was es mit dieser Art der Personalbeschaffung auf sich hat und wie sie gelingt
Traditionell suchen Unternehmen mithilfe von Stellenanzeigen neue Mitarbeiter. Diese Form des Recruitings ist aber nicht mehr immer erfolgreich. Mit Active Sourcing finden Personaler passgenaue Kandidaten – müssen allerdings auch mehr Zeit und Arbeit investieren.Continue reading Active Sourcing: Was es mit dieser Art der Personalbeschaffung auf sich hat und wie sie gelingt →
Post-Holiday-Syndrom: So vermeiden Arbeitnehmer und Chefs das Stimmungstief nach dem Urlaub
Erholt und voller Tatendrang aus den Ferien zurück an die Arbeit? Fehlanzeige! Bei zahlreichen Berufstätigen ist genau das Gegenteil der Fall: Wer gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt ist, tut sich oft schwer damit, wieder in die gewohnten Arbeitsprozesse einzusteigen. Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Stress sind die Folge. Dieses Tief nach dem Urlaub hat einen Namen: Post-Holiday-Syndrom.Continue reading Post-Holiday-Syndrom: So vermeiden Arbeitnehmer und Chefs das Stimmungstief nach dem Urlaub →
Karriere verweigern, Lebensglück steigern!?
Die klassische Karriere wird heutzutage von Arbeitnehmern immer häufiger in Frage gestellt. Das Streben, auf der Karriereleiter Stück für Stück nach oben zu gelangen, verträgt sich kaum mit einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. Und diese ist vielen „Karriereverweigerern“ mittlerweile deutlich wichtiger als Geld, Posten und Prestige.Continue reading Karriere verweigern, Lebensglück steigern!? →
So können sich Unternehmen sozial engagieren
Das Thema Nächstenliebe spielt in der Weihnachtszeit eine wichtige Rolle. Denjenigen zu helfen, denen es nicht so gut geht, sollte jedoch das ganze Jahr über praktiziert werden. Zu den Hilfsbedürftigen gehören heutzutage aber nicht nur Menschen aus Fleisch und Blut, sondern im übertragenen Sinne auch die Umwelt. Unternehmen tragen in der Gesellschaft eine große Verantwortung.Continue reading So können sich Unternehmen sozial engagieren →
Mündliche Kündigung: Ist sie gültig? Und wie geht man damit um?
Bei einem Streit zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter fallen schon einmal Sätze wie “Ich kündige” oder “Sie sind gefeuert”. Aber ist das Arbeitsverhältnis damit wirklich beendet? Und was tun Betroffene am besten, wenn sie eine mündliche Kündigung erhalten? Ein Überblick.Continue reading Mündliche Kündigung: Ist sie gültig? Und wie geht man damit um? →
Gamification: Wie funktioniert die spielerische Weiterbildung?
Lebenslanges Lernen gehört in der modernen Arbeitswelt dazu. Doch das fällt nicht immer leicht. Gamification ist eine Methode, um besonders schwierige oder trockene Inhalte besser zu vermitteln, einfacher zu verstehen und langfristig im Gedächtnis zu behalten.Continue reading Gamification: Wie funktioniert die spielerische Weiterbildung? →
Weiterbildung beantragen: 5 Argumente, die den Chef überzeugen
Viele Firmen nehmen das Thema Weiterbildung sehr ernst und investieren in die Schulung ihrer Mitarbeiter. Schwierig kann es allerdings werden, wenn Angestellte eine individuelle Weiterbildung machen möchten, die vom allgemeinen “Lehrplan” abweicht. In diesem Fall sind gute Argumente wichtig, mit deren Hilfe der Chef vom Nutzen der Maßnahme überzeugt werden kann.Continue reading Weiterbildung beantragen: 5 Argumente, die den Chef überzeugen →
Gute Neujahrsvorsätze einhalten: 3 Tipps für die Umsetzung
Der Jahreswechsel soll eine positive Veränderung mit sich bringen. Um sich zu motivieren, formulieren Menschen Neujahrsvorsätze. Sei es, mehr Sport zu machen, die Familie öfter zu sehen oder die eigene Karriere voranzutreiben. Die meisten guten Vorsätze scheitern jedoch schnell am Alltag.
Anhand der folgenden Tipps wird klar, warum so viele Menschen ihre Ziele nicht erreichen – und wie die Einhaltung der Neujahrsvorsätze tatsächlich gelingen kann.Continue reading Gute Neujahrsvorsätze einhalten: 3 Tipps für die Umsetzung →
“Out of the box”-Denken: Tipps, um über den Tellerrand zu blicken
Wenn im Job Kreativität gefragt ist, fällt nicht selten der Satz: “Think outside the box!” Wörtlich übersetzt werden Mitarbeiter demnach aufgefordert, außerhalb ihrer “Box” zu denken. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Und wie geht das?Continue reading “Out of the box”-Denken: Tipps, um über den Tellerrand zu blicken →
3 Tipps für eine coronakonforme Weihnachtsfeier
Bis in den Herbst hinein haben viele Unternehmen darauf gehofft, in diesem Jahr „normale“ Weihnachtsfeiern ausrichten zu können. Angesichts der rasanten Entwicklung der Coronazahlen scheint das leider in den meisten Fällen nicht möglich zu sein. Die lokalen Regelungen geben dabei den Rahmen vor und sind entscheidend dafür, ob Präsenzveranstaltungen mit 3G, 2G, 2G+ (oder eventuell gar nicht) stattfinden dürfen.Continue reading 3 Tipps für eine coronakonforme Weihnachtsfeier →
Wie wird man Influencer?
Über drei Milliarden Menschen sind in sozialen Netzwerken aktiv. Die meisten von ihnen nutzen Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok, Twitter oder Facebook. Wer als Star oder Sternchen dort präsent ist, kann sich fast automatisch über viele Follower freuen. Mancher Prominente mehrt dadurch nicht nur seinen Ruhm, sondern füllt nebenbei auch seinen Geldbeutel. Zu den ersten „Stars“, die das erkannt haben, gehört sicherlich das „It-Girl der 2000er-Jahre“ Paris Hilton.Continue reading Wie wird man Influencer? →
Konfliktmanagement – mit Mediation Probleme lösen
In Unternehmen kommt es häufig zu Konfliktsituationen. Man schätzt, dass Führungskräfte 30 bis 50 Prozent ihrer Arbeitszeit direkt oder indirekt damit verbringen, Streitigkeiten zu schlichten und Lösungen herbeizuführen. Im Endeffekt kosten Konflikte Zeit, Nerven und Geld.
Wenn Interessen und Bedürfnisse kollidieren und eine Lösung nicht mehr möglich scheint, kann eine Mediation die letzte Chance auf eine Einigung sein. In diesem Artikel stellen wir Ihnen diese Methode des Konfliktmanagements genauer vor.Continue reading Konfliktmanagement – mit Mediation Probleme lösen →
Fortbildung vs. Weiterbildung: Das ist der Unterschied
Die Begriffe Fortbildung und Weiterbildung werden oft verwendet, als wären sie gleichbedeutend – sind sie aber nicht. Der wichtigste Unterschied ist das Ziel der jeweiligen Maßnahme. Dieses entscheidet darüber, für wen eine Fortbildung sinnvoll ist und für wen sich eher eine Weiterbildung eignet.Continue reading Fortbildung vs. Weiterbildung: Das ist der Unterschied →