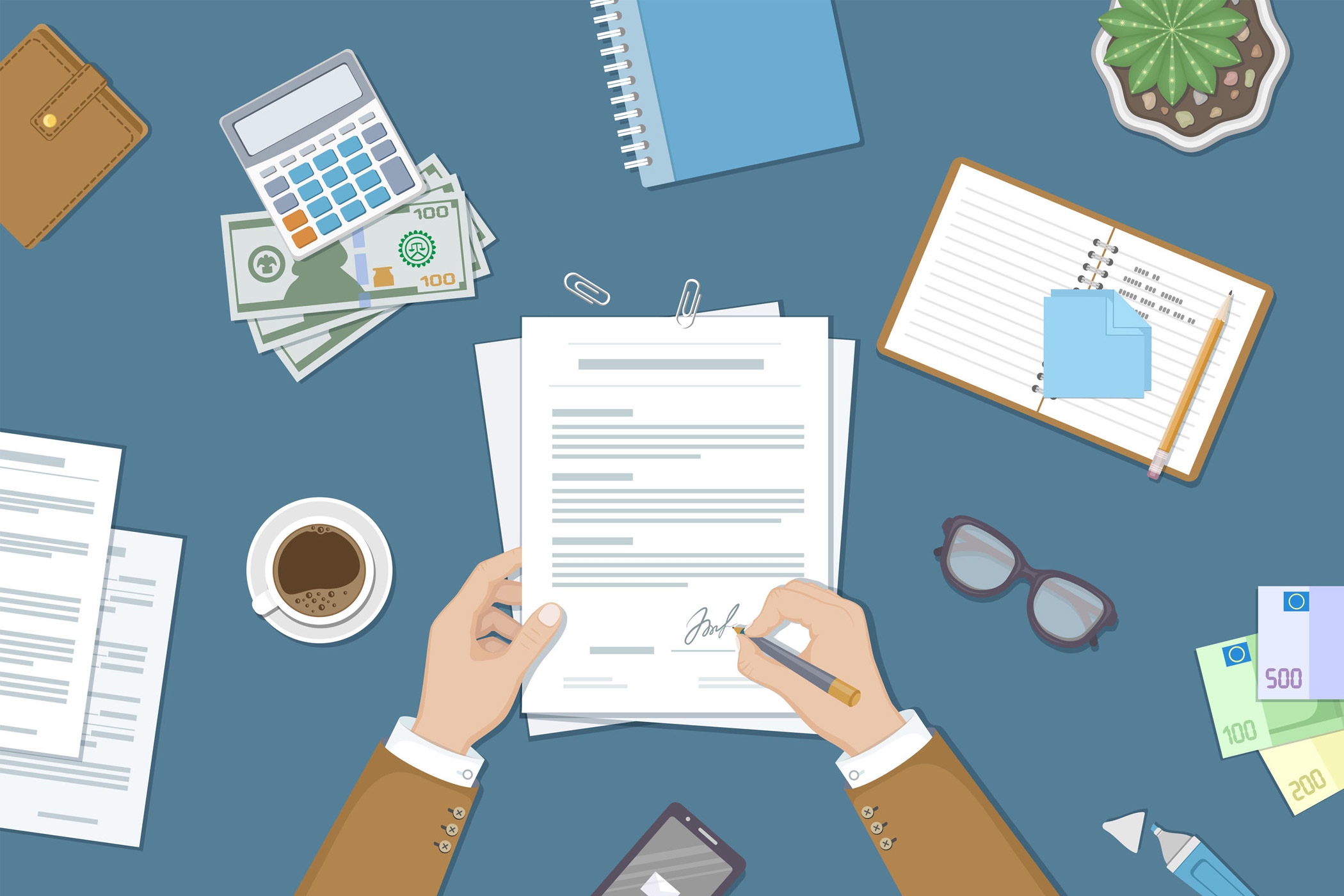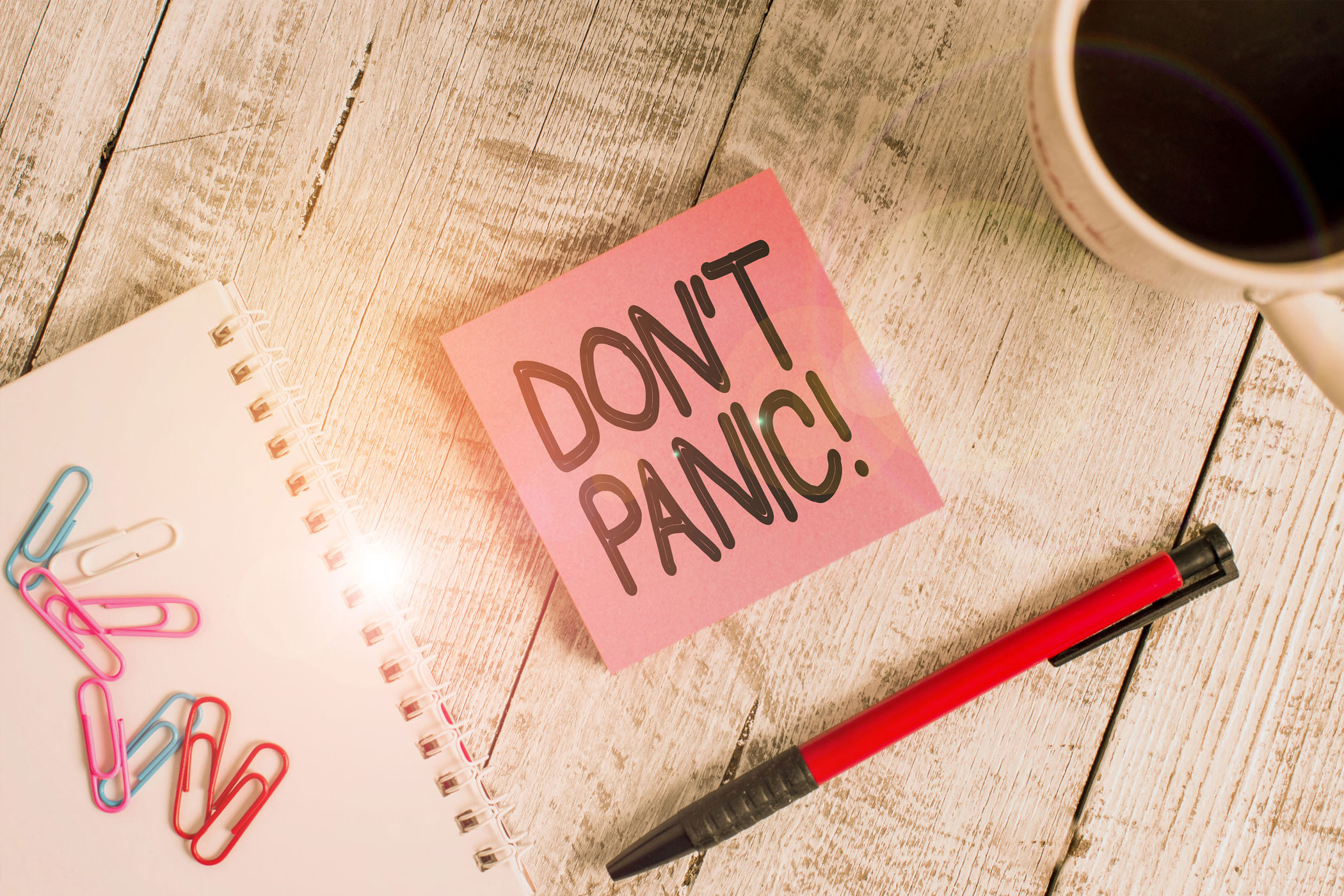Jahrelang hat man mit den Vorgesetzten gerungen, um ab und zu die Vorzüge des Home Offices in Anspruch nehmen zu dürfen. Einen Tag in der Woche – oder zumindest im Monat – das wären für Viele paradiesische Zustände!
Doch dann kam Corona … und hat dafür gesorgt, dass das Home Office für viele Angestellte zur Regel, statt zur Ausnahme geworden ist. Das Virus hat gegen die Zweifel aller Bedenkenträger gewonnen. Aber von paradiesischen Zuständen sind die meisten leider meilenweit entfernt.
5 Übungen für die Augen: So werden sie wieder fit
Wer viel Zeit vor dem PC verbringt und lange auf den Bildschirm schaut, strapaziert auf Dauer seine Augen. Trockenheit oder Augenbrennen sind dabei nur zwei der unschönen Symptome. Doch mit ein paar einfachen Übungen täglich kann man seinen Augen etwas Gutes tun und sie bei dieser ständigen Anstrengung ein wenig entlasten.
Hobbys: So macht der Zeitvertreib erfolgreich
Studien zeigen: Wer einem Hobby nachgeht, sorgt nicht nur für sich selbst und das eigene Wohlbefinden, sondern kann damit auch seinen beruflichen Erfolg beeinflussen. Dabei ist es egal, welchem Hobby man nachgeht. Hauptsache, es macht Spaß – frei von Zeit- und Leistungsdruck.
Unterschriftenzusätze und Businessabkürzungen: Das bedeuten i.A., i.V. und ppa.
Im Joballtag ist man häufig mit Businessabkürzungen konfrontiert. Gerade im Bereich rund um E-Mail-Signaturen und Unterschriften gibt es viele Kürzel wie zum Beispiel i.A., i.V. oder ppa. Doch was bedeuten diese Buchstaben eigentlich genau?
Verspannungen lösen: 5 Übungen gegen den Muskelschmerz
Ob im Hals-Nacken-Bereich, in den Schultern, im Rücken oder sogar in den Armen und Beinen – wer sich einseitig bewegt oder sitzt, spürt schnell die ersten Anzeichen von Verspannungen. Dabei kann nicht nur eine schlechte Sitzhaltung am Arbeitsplatz der Grund für den Muskelschmerz sein, sondern auch Stress, Zugluft, falsche Schuhe, alte Verletzungen, Übergewicht oder eine schlechte Matratze. Verspannungen entstehen immer, wenn der Muskel mit zu wenig Sauerstoff versorgt wird. Folge: Viele nehmen eine Schonhaltung ein, was den Schmerz allerdings noch schlimmer macht.
Onboarding – So klappt die Integration neuer MitarbeiterInnen
Damit sich neue Mitarbeiter auf Anhieb im Unternehmen wohl fühlen und möglichst schnell produktiv sein können, sollte der Eingliederungsprozess gut durchdacht sein. Das sogenannte Onboarding ist eine Strategie, die dabei helfen kann. In unserem Artikel beschäftigen wir uns mit den folgenden Fragen: Was versteht man genau unter Onboarding? Wer sollte am Onboarding beteiligt sein? Welche Vorteile erhofft man sich?
Ziele erreichen mit dem Cliffhanger-Effekt: So geht’s
Wirkungsvolle Cliffhanger sind eines der größten Erfolgsgeheimnisse langlebiger Fernsehserien. Und auch für die Arbeitswelt kann der Effekt genutzt werden. Mit kleinen Tricks hält man das eigene Gehirn auf Trab und erreicht so leichter seine Ziele. Was ist der Cliffhanger-Effekt? Der sogenannte Cliffhanger-Effekt ist aus der Serienwelt hinlänglich bekannt: Weil eine Folge mit einem ungelösten ZwischenfallContinue reading Ziele erreichen mit dem Cliffhanger-Effekt: So geht’s →
Faszination Briefmarke (Teil 1): Vorgeschichte und Einführung der Briefmarke
Vor über 180 Jahren erblickte die erste Briefmarke das Licht der Welt. Die „One Penny Black“ wurde Anfang Mai 1840 im Vereinigten Königreich herausgegeben. Sie war damit das nach außen und für alle sichtbare Zeichen für die Reformierung und Vereinfachung des Postwesens. Seit der Einführung der Briefmarke wurden schon viele Abgesänge auf sie verfasst. AuchContinue reading Faszination Briefmarke (Teil 1): Vorgeschichte und Einführung der Briefmarke →
Stehen wir wegen Corona kurz vor einer Insolvenzwelle?
Die Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft im Frühjahr mit voller Wucht getroffen. Zwar ist Deutschland wirtschaftlich stabiler aufgestellt als andere Nationen, dennoch verschlimmern sich die finanziellen Probleme auch hierzulande von Tag zu Tag. Legt man die Schuldenquote zugrunde, hatte Deutschland mit einer Schuldenquote von ca. 60 Prozent die „lukrative“ Situation, problemlos neue Kredite aufzunehmen. Über einContinue reading Stehen wir wegen Corona kurz vor einer Insolvenzwelle? →
Corona-Aerosole in Büroräumen
Viele wissenschaftliche Studien kommen zu dem Schluss, dass Aerosole mitverantwortlich für die Verbreitung des Coronavirus sind. Bei Aerosolen handelt es sich um Mikrotröpfchen, die weniger als fünf Mikrometer groß und für das bloße Auge unsichtbar sind. Diese können Viruspartikel enthalten. Atmet, hustet oder niest ein Corona-Infizierter können Virenwolken entstehen, die eine Ansteckung begünstigen. Das giltContinue reading Corona-Aerosole in Büroräumen →
Feelgood Management: 5 Tipps für eine bessere Arbeitsatmosphäre
Eine gute Arbeitsatmosphäre ist heute wichtiger denn je, um die eigenen Angestellten zu optimaler Leistung anzuspornen und die Mitarbeiterbindung zu stärken. In diesem Zusammenhang fällt immer häufiger der Begriff “Feelgood Management”. Wir erklären, was sich dahinter verbirgt, und geben Tipps für eine bessere Arbeitsatmosphäre. Was ist “Feelgood Management”? Hinter dem Begriff “Feelgood Management” verbirgt sichContinue reading Feelgood Management: 5 Tipps für eine bessere Arbeitsatmosphäre →
Was bedeutet der Klimawandel für Bürojobs?
Der Klimawandel wird nur noch von wenigen angezweifelt. Die überwiegende Mehrheit der Forscher ist sich sicher, dass der Mensch hauptverantwortlich ist für die überproportionalen Änderungen. Vor allem die Klimaerwärmung ist alarmierend. Mindestens seit dem Jahr 2000 jagt förmlich ein Temperaturrekord den nächsten. Die Auswirkungen sind heute schon sehr offensichtlich. Die Eisdecken an Nord- und SüdpolContinue reading Was bedeutet der Klimawandel für Bürojobs? →
Gut schlafen trotz Hitze: So klappt’s mit der erholsamen Nachtruhe
Fast jeder liebt ihn: den Sommer. Schönes Wetter, warme Temperaturen und mehr Bewegung an der frischen Luft sorgen für gute Laune – aber leider oft auch für einen unruhigen Schlaf. Denn: Die warmen Temperaturen verhindern, dass die Körpertemperatur nachts ausreichend absinken kann. Wir schlafen weniger und vor allem unruhiger. Dass es spät dunkel und frühContinue reading Gut schlafen trotz Hitze: So klappt’s mit der erholsamen Nachtruhe →
FAQ Corona Warn-App: Die wichtigsten Infos für Chefs und Arbeitnehmer
Die Corona-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem. Neben den schon obligatorischen Maßnahmen wie Abstand halten und Nasen-Mundschutz tragen, soll jetzt eine Corona Warn-App dabei helfen, die Coronakrise besser in den Griff zu bekommen. Die Bundesregierung hat die „kostenlose“ Warn-App entwickeln lassen, damit schneller auf Infektionsausbrüche reagiert werden kann. Die App, deren Entwicklung und BetriebContinue reading FAQ Corona Warn-App: Die wichtigsten Infos für Chefs und Arbeitnehmer →
5 Übungen gegen den Mausarm
Die Arbeit am Rechner kann den Körper belasten. Zu wenig Bewegung und falsche Haltung am Arbeitsplatz fordern nach einiger Zeit ihren Tribut. Neben Rückenproblemen ist auch der sogenannte Mausarm daher weit verbreitet. Medizinisch korrekt bezeichnet handelt es sich hierbei um das Repetitive-Strain-Injury-Syndrom (RSI-Syndrom). Abgesehen von Händen und Handgelenken können hiervon auch die Unterarme, Ellbogen, SchulternContinue reading 5 Übungen gegen den Mausarm →
Durchhalten! Tipps für stressige Phasen im Arbeitsleben und Alltag
Im Arbeitsleben ebenso wie im Alltag kann es immer wieder zu stressigen Phasen kommen. Oft hält sich die Zeitspanne dabei überschaubar, ein Ende der stressigen Zeit ist in Sicht. Etwa, weil der Monatsendspurt bald geschafft ist, oder das Baby endlich beginnt, durchzuschlafen. Hier schaffen wir es noch recht gut, durchzuhalten und uns selbst zu motivieren.Continue reading Durchhalten! Tipps für stressige Phasen im Arbeitsleben und Alltag →
Tipps für die perfekte Ansage auf dem Anrufbeantworter
Der Anrufbeantworter springt an und Sie verspüren sofort den Impuls, aufzulegen? Ihren Anrufern geht es offenbar ähnlich? Das muss nicht sein! Mit den richtigen Tipps gestalten Sie die Ansage auf dem Gerät so, dass Ihre Anrufer auch tatsächlich Lust haben, Ihnen aufs Band zu sprechen. Und noch besser: Sie vermitteln einen kompetenten Eindruck, sogar dann,Continue reading Tipps für die perfekte Ansage auf dem Anrufbeantworter →
Präsentismus: Wenn sich Arbeitnehmer krank zur Arbeit schleppen
Nicht offiziell krank, aber auch nicht wirklich fit: Kommt ein Mitarbeiter angeschlagen zur Arbeit, handelt es sich um einen Fall von Präsentismus. Für dieses Verhalten kann es viele Gründe geben, darunter auch Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Was ist Präsentismus? Der Begriff “Präsentismus” bezeichnet ein Phänomen, das jeder sicherlich bereits an seinem Arbeitsplatz beobachtet hat. EinContinue reading Präsentismus: Wenn sich Arbeitnehmer krank zur Arbeit schleppen →
Mund-und Nasen-Maske einfach selber basteln – ohne Nähen
Seit dem 27. April gilt in Deutschland bundesweit die Maskenpflicht. Aufgrund der hohen Nachfrage ist es jedoch gar nicht so leicht, sich eine Maske zu besorgen. Masken sind Mangelware – in vielen Supermärkten sind sie nicht erhältlich oder ausverkauft. Auch bei Bestellungen im Internet ist man auf Glück angewiesen und wenn Masken verfügbar sind, dauertContinue reading Mund-und Nasen-Maske einfach selber basteln – ohne Nähen →
Kaffee-Alternativen: Gesunde Wachmacher für den Start in den Tag
Nach dem Aufstehen brauchen Sie erst einmal eine Tasse Kaffee? Dann geht es Ihnen wie gut 60 Prozent der Menschen in Deutschland. Der koffeinhaltige Wachmacher gehört hierzulande zu den beliebtesten Getränken. Dabei gibt es für den Power-Kick am Morgen viele gesunde Alternativen. Welche? Das verraten wir Ihnen hier. Ihr Kaffeekonsum ist ins Unermessliche gestiegen? MöglicherweiseContinue reading Kaffee-Alternativen: Gesunde Wachmacher für den Start in den Tag →