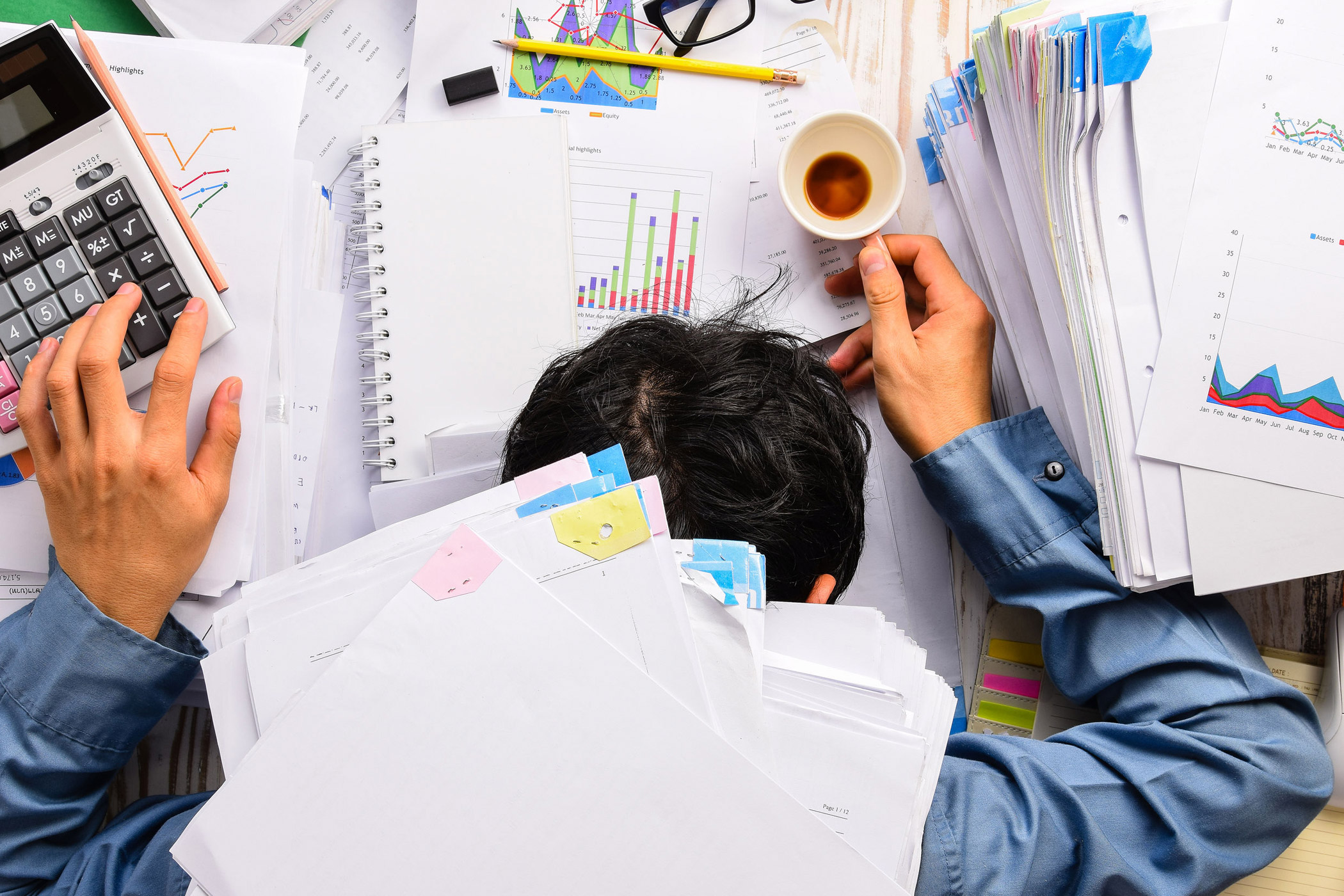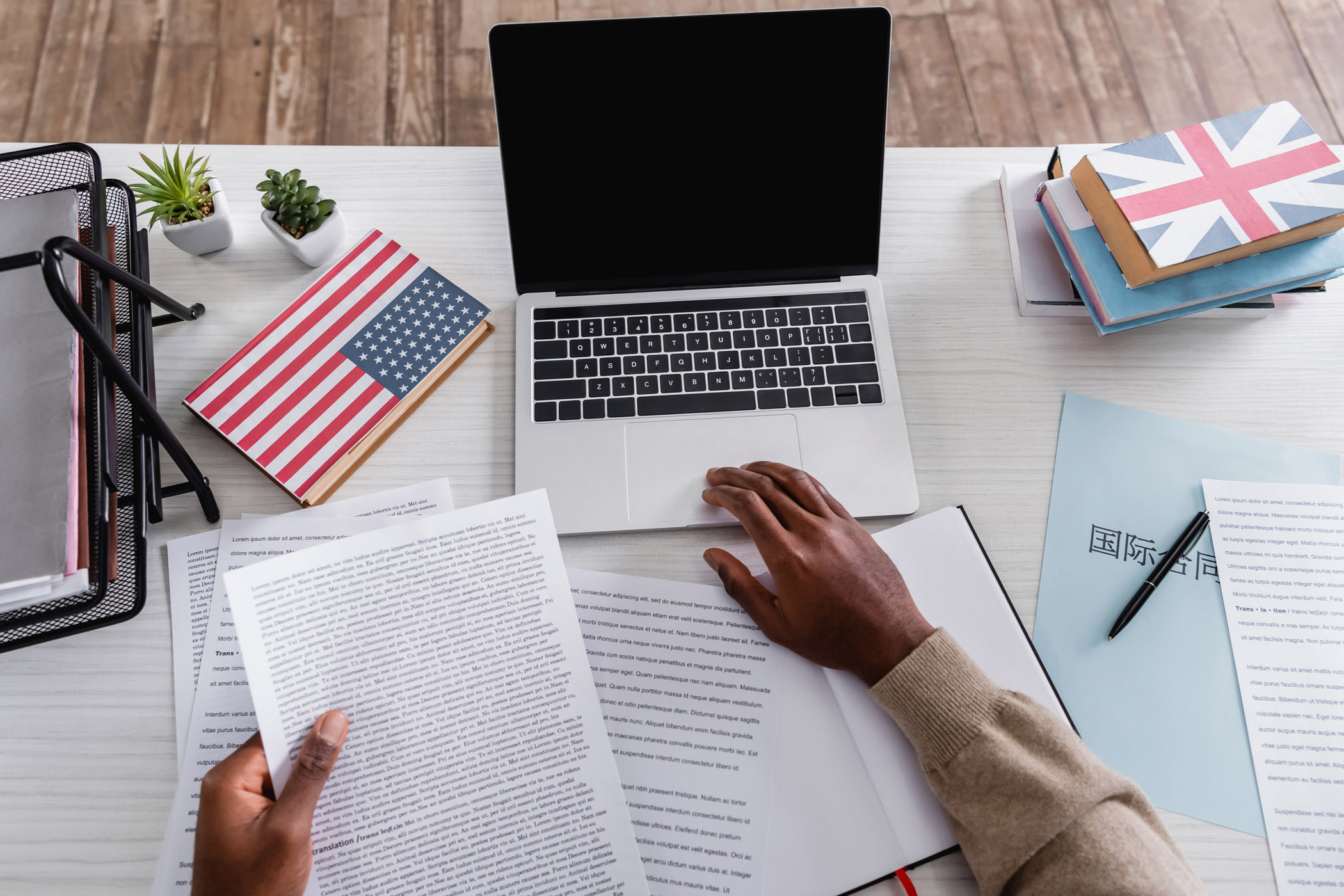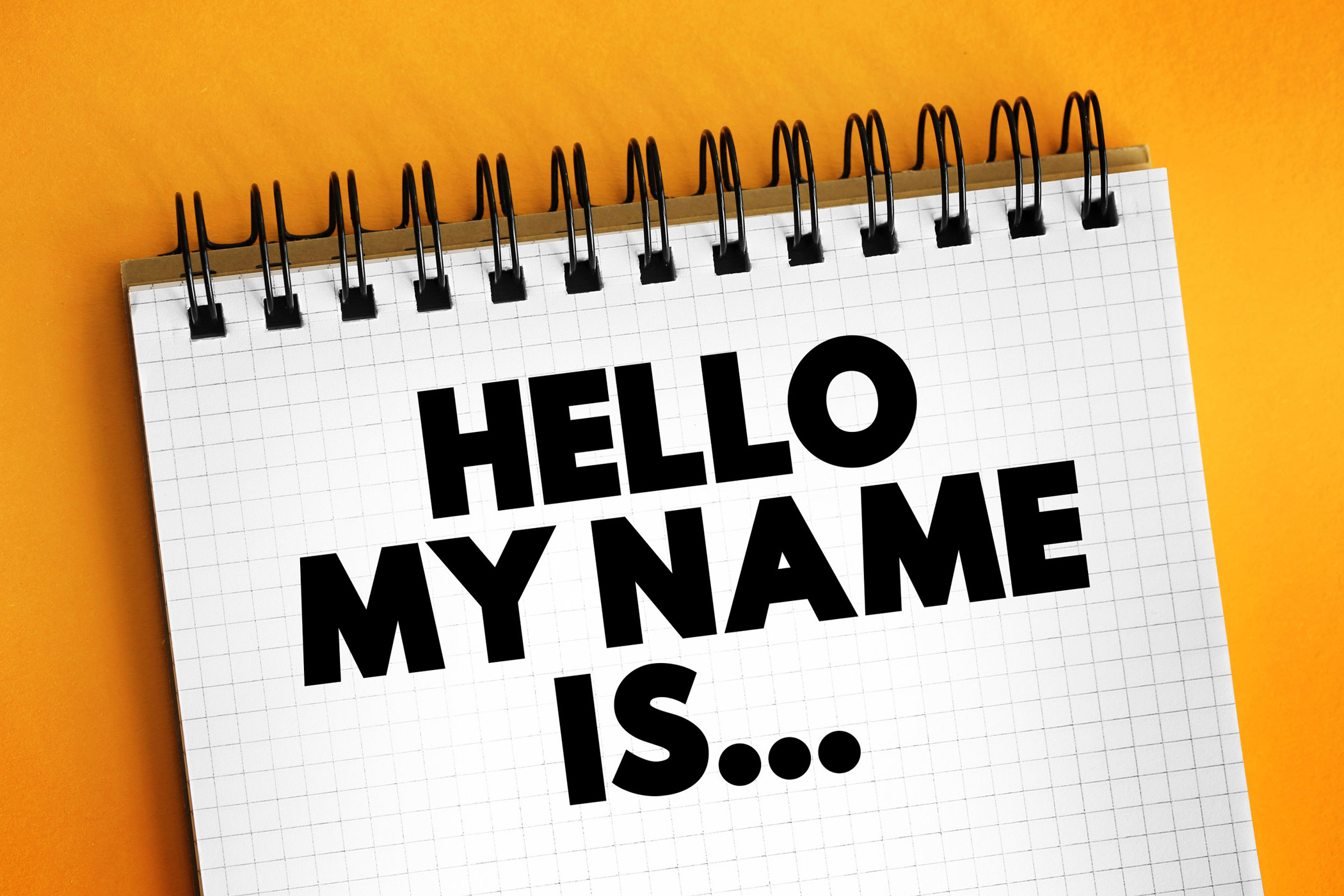Die Preise für Benzin und Diesel haben ein Niveau erreicht, das viele Autofahrer verzweifeln lässt. Mit einem Tankrabatt will die Bundesregierung nun übergangsweise für eine finanzielle Entlastung sorgen. Profitieren sollen vor allem die Pendler, die Tag für Tag für den Weg zur Arbeit auf ihr Auto angewiesen sind. Aber reicht dieser Rabatt aus und wasContinue reading Steigende Spritpreise – wie Pendler Kosten sparen können
Pst, nicht weitersagen – was es mit der Schweigepflicht auf sich hat
Es gibt Dinge, die gehören zur Privatsphäre und gehen andere Menschen nichts an. Dazu gehören zum Beispiel der Gesundheitszustand, familiäre Probleme und die Finanzen. Gegenüber bestimmten Berufsgruppen muss man all diese persönlichen Angelegenheiten aber manchmal schon offenbaren. Damit diese „Geheimnisse“ bei Ärzten, Notaren und Rechtsanwälten gut aufgehoben sind und nicht an Dritte weitergegeben werden, gibtContinue reading Pst, nicht weitersagen – was es mit der Schweigepflicht auf sich hat →
Kann Workation funktionieren?
Arbeit und Urlaub miteinander verbinden – dieses Konzept steckt hinter dem Kunstwort Workation, zusammengesetzt aus den englischen Begriffen „work“ (Arbeit) und „vacation“ (Urlaub). Unter welchen Bedingungen kann Workation funktionieren? Ist das Prinzip zukunftsfähig? Workation: Arbeit und Urlaub vereinen Die Corona-Krise hat zu einigen Veränderungen im Arbeitsleben geführt. Während des Lockdowns wurde das in Deutschland bislangContinue reading Kann Workation funktionieren? →
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – so kann man sich wehren
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist leider keine Seltenheit. Wie eine Statistik der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahr 2015 zeigt, haben mehr als 50 Prozent aller Beschäftigten bereits sexuelle Übergriffe auf der Arbeit erlebt oder waren Zeuge davon. Die meisten Betroffenen sind Frauen, doch auch Männer können Opfer von anzüglichen Bemerkungen und Berührungen werden. DieserContinue reading Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – so kann man sich wehren →
Die Grenzen der Loyalität
Unternehmen wünschen sich loyale Mitarbeiter. Doch was bedeutet Loyalität überhaupt? Wie können Firmen die Loyalität ihrer Beschäftigten gewinnen? Und wie erkennen Arbeitnehmer, dass Ihre Loyalität ausgenutzt wird? Dieser Beitrag gibt Antworten. Loyalität – eine innere Haltung Der Begriff Loyalität kommt aus dem Französischen und lässt sich auch mit „Anständigkeit“ übersetzen. Er geht auf das lateinischeContinue reading Die Grenzen der Loyalität →
Sonderurlaub – dafür gibt es extra freie Tage
Wer heiratet, Vater wird oder umzieht, hat einen guten Grund nicht bei der Arbeit zu erscheinen. Für diese besonderen Ereignisse muss nicht einmal einer der wertvollen Urlaubstage geopfert werden. Denn jetzt gibt es Sonderurlaub. Wem und unter welchen Voraussetzungen die Extra-Tage zustehen und was das Gesetz dazu sagt, erklärt dieser Ratgeber. Das sagt das GesetzContinue reading Sonderurlaub – dafür gibt es extra freie Tage →
Kühlschrank im Büro – diese coolen Regeln gelten im Büro
Als Service für die Mitarbeiter, die darin frische und verderbliche Lebensmittel aufbewahren können, gibt es in fast jeder Büroküche auch einen Kühlschrank. Fast mag man es nicht glauben, aber das Elektrogerät birgt ein nicht unerhebliches Konfliktpotential. Um Unstimmigkeiten unter den Kollegen zu vermeiden, gibt es aber einige praktische Tipps und Tricks zum coolen Umgang mitContinue reading Kühlschrank im Büro – diese coolen Regeln gelten im Büro →
Mein Chef ist 25 – wie Mitarbeiter mit jungen Vorgesetzten umgehen
„Was kann der mir schon sagen, er hat doch noch gar keine Erfahrung!“ oder: „Mit dem theoretischen Uni-Wissen kommt er bei uns nicht weit!“ Diese ohne ähnliche Gedanken kommen vielen langjährigen Mitarbeitenden in den Kopf, wenn ihnen plötzlich ein neuer und sehr junger Chef vor die Nase gesetzt wird. Wir haben hilfreiche Tipps, wie manContinue reading Mein Chef ist 25 – wie Mitarbeiter mit jungen Vorgesetzten umgehen →
Home Office mit Handy – häufige Fehler in englischen E-Mails entdecken (und künftig vermeiden)
Auch in Deutschland ist die Arbeitswelt längst international geworden. Rund die Hälfte aller Arbeitnehmer muss im Job regelmäßig in einer Fremdsprache kommunizieren. Es gibt heute schließlich kaum noch Unternehmen, die nicht Zweigstellen, Niederlassungen, Partner oder Dienstleister im Ausland haben. Sprechen die Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner oder auch Kollegen nicht deutsch, dann läuft die Kommunikation meist inContinue reading Home Office mit Handy – häufige Fehler in englischen E-Mails entdecken (und künftig vermeiden) →
Lästereien am Arbeitsplatz – so geht man damit um
„Hast du schon gehört, dass …?“ Ein bisschen Klatsch und Tratsch gehört im Büroalltag einfach dazu. Der Grat zwischen Austausch von Neuigkeiten und Lästereien ist jedoch häufig schmal. Über andere Kollegen (schlecht) zu reden, ist dabei häufig mehr als nur eine Feststellung von Tatsachen. Und auch wenn Lästereien ein absolutes No-Go sein sollten, kommen sieContinue reading Lästereien am Arbeitsplatz – so geht man damit um →
Andreas & Katja – diese Vornamen sind besonders erfolgreich im Job
Um im Job erfolgreich zu sein, gutes Geld zu verdienen und vielleicht sogar eine Führungsposition zu bekommen, benötigt man nicht nur Fachwissen, Berufserfahrung und weitere Kompetenzen, sondern auch den richtigen Vornamen. Auch wenn es befremdlich und fast schon unfair klingen mag, ist es tatsächlich so, dass es ein Dirk oder eine Sabine einfacher hat, KarriereContinue reading Andreas & Katja – diese Vornamen sind besonders erfolgreich im Job →
Straining – die erzwungene Langeweile am Arbeitsplatz
Während die einen regelrecht in Arbeit untergehen, nicht wissen, was sie zuerst und zuletzt tun sollen, gibt es auch diejenigen, die überhaupt keine Aufgaben haben und sich tagein, tagaus am Arbeitsplatz nur langweilen. Entzieht der Arbeitgeber Mitarbeitenden bewusst sämtliche Aufgaben, handelt es sich um eine besondere Form des Mobbings – Straining. Zäh wie Kaugummi –Continue reading Straining – die erzwungene Langeweile am Arbeitsplatz →
Kennen Sie TED?
TED – diese drei Buchstaben stehen für Technology, Entertainment, Design. Hinter dem Namen verbirgt sich eine jährlich stattfindende Innovationskonferenz. Dort zu hören und zu sehen gibt es kurze, inspirierende Vorträge aus zahlreichen Themengebieten. Die TED-Talks-Website stellt die besten Vorträge als Videos mit Untertiteln in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Was das Besondere an den TED-Talks istContinue reading Kennen Sie TED? →
„Stromberg“ oder „The Office US“?
Am 30. August 2001 ging die Pilotfolge der britischen Comedy-Serie „The Office“ auf Sendung. Ricky Gervais spielt die Hauptrolle des David Brent, Chef einer Papiergroßhandelsfirma. Die Serie folgt dem Personal im Stil einer Langzeitdokumentation. Ihren Humor bezieht sie vor allem daraus, dass Brent seine professionellen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten maßlos überschätzt. „The Office“ blieb nur fürContinue reading „Stromberg“ oder „The Office US“? →
Vor- und Nachteile von altersgemischten Teams
Der demografische Wandel verändert auch die Altersstruktur in Betrieben. Ältere Mitarbeiter bleiben länger im Berufsleben, gleichzeitig kommen weniger junge Fachkräfte nach. Unternehmen reagieren auf diese Herausforderung unter anderem, indem sie altersgemischte Teams zusammenstellen. Die Zusammenarbeit von jüngeren und älteren Beschäftigten bietet viele Vorteile, kann aber auch zu Konflikten führen. Welche Faktoren sind zu beachten, damitContinue reading Vor- und Nachteile von altersgemischten Teams →
Lohnsteuerhilfeverein – die günstige Alternative zum Steuerberater
Sie gehört eindeutig zu den Dingen, die wir gerne aus der Hand geben und lieber andere machen lassen. Die Steuererklärung ist für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln, sie raubt Zeit und bedeutet Stress, ist gleichzeitig aber wichtig und teilweise sogar verpflichtend. Wer zwar professionelle Unterstützung braucht, jedoch nicht die hohen Kosten für denContinue reading Lohnsteuerhilfeverein – die günstige Alternative zum Steuerberater →
Liebe unter Kollegen – wichtige (und unromantische) Fakten zur Beziehung am Arbeitsplatz
Den Großteil unseres Tages verbringen wir am Arbeitsplatz. Es verwundert daher wenig, dass wir mit der Zeit einen guten und vertrauten Kontakt zu unseren Kollegen haben. Nicht immer bleibt es bei der Freundschaft, sondern es entwickelt sich Liebe daraus. Und das gar nicht so selten: Immerhin jede dritte Beziehung beginnt in Deutschland am Arbeitsplatz. WasContinue reading Liebe unter Kollegen – wichtige (und unromantische) Fakten zur Beziehung am Arbeitsplatz →
Prokrastination: Was ich heute kann besorgen, verschieb ich liebend gern auf morgen
Der unangenehme Anruf bei einem Kunden, den man vor sich herschiebt, die Ablage, zu der man sich nicht aufraffen kann oder das Protokoll, das schon seit Wochen darauf wartet, endlich geschrieben zu werden – wir alle kennen das Phänomen, unangenehme Aufgaben aufzuschieben und sich stattdessen lieber anderen Dingen zu widmen. Wenn dieses Verhalten aber nichtContinue reading Prokrastination: Was ich heute kann besorgen, verschieb ich liebend gern auf morgen →
5 einfache, aber effektive Psycho-Tricks, um berufliche Ziele zu erreichen
Um im Job weiterzukommen, ist es gar nicht nötig, die Ellenbogen auszufahren. Viel angenehmer ist es doch, von den Kollegen und vom Chef gemocht zu werden, zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre beizutragen und on top sogar noch seine beruflichen Ziele zu erreichen. Kleine Psycho-Tricks können dabei helfen – sofern sie wohl dosiert sind und natürlich niemandemContinue reading 5 einfache, aber effektive Psycho-Tricks, um berufliche Ziele zu erreichen →
Es werde Licht – die optimale Beleuchtung am Arbeitsplatz
Wenn an einem Sommertag die Sonne von einem wolkenlosen Himmel strahlt, ist das für die meisten Menschen ein Gute-Laune-Garant. Anders sieht es an einem trüb-nebligen Wintertag aus, an dem es gar nicht richtig hell werden will. Licht hat einen wichtigen Einfluss auf unseren Körper. Vor allem helles und natürliches Tageslicht hebt die Stimmung, steigert unsereContinue reading Es werde Licht – die optimale Beleuchtung am Arbeitsplatz →