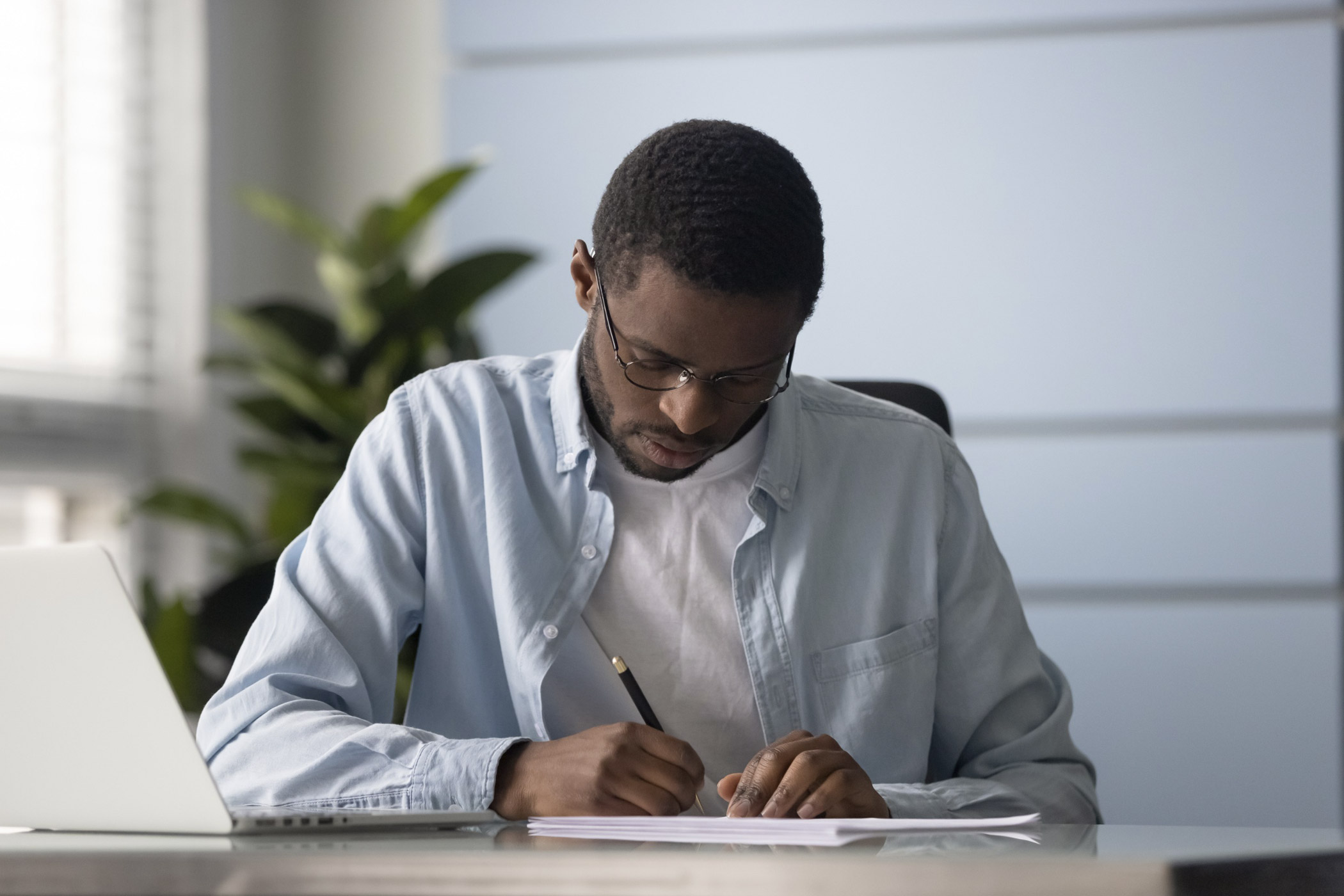Coffee Badging – wenn das Büro zum Café wird
Die Vorzüge des Homeoffice haben Angestellte in den letzten Jahren zu schätzen gelernt. Dementsprechend sind viele von ihnen wenig begeistert, wenn sie an einigen Tagen wieder persönlich im Büro erscheinen müssen. Um ihre Anwesenheitspflicht möglichst kurz zu halten, gibt es immer mehr Beschäftigte, die sehr kreativ werden. Sie sorgen dafür, dass sich Coffee Badging immer mehr als neuer Arbeitstrend verbreitet.
Die Ausgangssituation oder die Gründe für die Unlust, ins Büro zu kommen
Corona ist schuld! Wenn auch stark vereinfacht, ist an dieser Behauptung auf jeden Fall etwas dran. Denn mit Aufkommen der Pandemie und den damit verbundenen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wurden viele Menschen ins Homeoffice geschickt, um daheim zu arbeiten. Was zunächst kritisch beäugt wurde, hat ein Großteil der Angestellten mit der Zeit durchaus zu schätzen gelernt. In den eigenen vier Wänden entfällt zum Beispiel die Fahrtzeit zum Betrieb, ein aufwendiges Styling ist nicht notwendig, man kann zwischendurch auch mal die Wäsche aufhängen und überhaupt arbeitet es sich im Homeoffice viel entspannter als unter dem kritischem Blick des Chefs im Büro. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass es immer mehr Angestellten so gar nicht schmeckt, dass ihre Vorgesetzten zumindest an einigen Tagen wieder Präsenzpflicht fordern.
Was ist Coffee Badging?
An dieser Stelle kommt nun das Coffee Badging ins Spiel. Es beschreibt das Phänomen, dass Mitarbeitende zwar ihrer Anwesenheitspflicht nachkommen, das Büro aber bereits nach einigen Stunden beziehungsweise nach kürzerer Zeit wieder verlassen, um zu Hause weiterzuarbeiten. Die Zeit am Arbeitsplatz nutzen sie dabei weniger zum Arbeiten selbst als vielmehr, um Gesicht zu zeigen. Dabei stehen besonders die sozialen Aspekte im Fokus: So unterhält man sich in der Präsenzzeit auch mal gerne mit den Kollegen bei einem Kaffee.
Hier erklärt sich jetzt auch die kreative Wortschöpfung. Der englische Begriff bezieht sich einerseits auf die Kaffeepause und andererseits auf das „Ein- und Ausstempeln“ am Arbeitsplatz – „Badge“ heißt wörtlich übersetzt so viel wie Ausweis oder Stempelkarte. Die heute meist digitale Stempelkarte ist ein System der Arbeitszeiterfassung, das Unternehmen dazu dient, die Arbeitszeiten der Mitarbeitenden zu dokumentieren und nicht zuletzt auch zu kontrollieren.
Wie kann man Angestellten das Arbeiten im Büro wieder schmackhaft machen?
Grundsätzlich können Unternehmen natürlich darauf drängen, dass ihre Mitarbeitenden an einem Tag oder an mehreren Tagen den kompletten Arbeitstag im Büro verbringen – das Risiko ist jedoch vorhanden, dass sie bei einem entsprechenden Zwang qualifiziertes Personal verlieren. Denn augenscheinlich haben die wenigsten Angestellten Lust darauf, von Montag bis Freitag wieder im Büro zu arbeiten. Um diese Einstellung zu ändern, sind Unternehmen gefragt, bestimmte zu Anreize schaffen. Das können zum Beispiel sein:
- Zuschüsse für Fahrtkosten: Wer sich monatelang das Benzin für den Pkw oder das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr gespart hat, ist mit Sicherheit wenig erfreut, wenn er das Geld dafür wieder aufbringen muss. Eine finanzielle Spritze für die Fahrtkosten mag hier einen kleinen Motivationsschub geben.
- Infrastruktur anpassen: Während man im Homeoffice von morgens bis abends eher ruhige Rahmenbedingungen hat, geht es vor allem in einem Großraumbüro ganz schön laut und wuselig zu. Und das kann ziemlich anstrengend sein, vor allem dann, wenn Angestellte es nicht mehr gewohnt sind. Unternehmen sind daher gut beraten, Rückzugsorte in Form von komfortabel eingerichteten Pausenräumen oder ruhigeren Workspaces einzurichten.
- soziale Aspekte hervorheben: Fragt man im Homeoffice arbeitende Menschen, sind es meist vor allem die Kollegen, die sie am privaten Arbeitszimmer vermissen. Genau diesen Aspekt können sich Vorgesetzte zunutze machen und zum Beispiel gemeinsame Aktivitäten (nach Feierabend) planen und anbieten. In größeren Unternehmen sind auch Vor-Ort-Angebote, zum Beispiel Fitnesskurse oder Kochabende, ein guter Anreiz, damit Mitarbeitende gerne ins Büro kommen.
- kulinarische Benefits bieten: Gibt es Kaffee for free und den sogar noch auf Knopfdruck und in Form von Cappuccino, Latte macchiato und Co., sehen das einige Mitarbeitende durchaus als Motivation, sich häufiger mal am Arbeitsplatz blicken zu lassen. Noch besser: Ein finanzieller Zuschuss für das Mittagessen dürfte weitere Zweifler überzeugen, dass es sich lohnen kann, im Büro zu arbeiten.
- gut argumentieren: Neben all den Taten dürfen auch gute Argumente nicht zu kurz kommen. Vorgesetzte sind gut beraten, die Vorzüge der Büroarbeit zu kommunizieren und mit motivierenden Worten zu verkaufen. Dabei mag es deutlich effektiver sein, auch weiterhin das Homeoffice an bestimmten Tagen zu erlauben, als es gänzlich zu verbieten.
Urheber des Titelbildes: gritsiv/ 123RF Standard-Bild