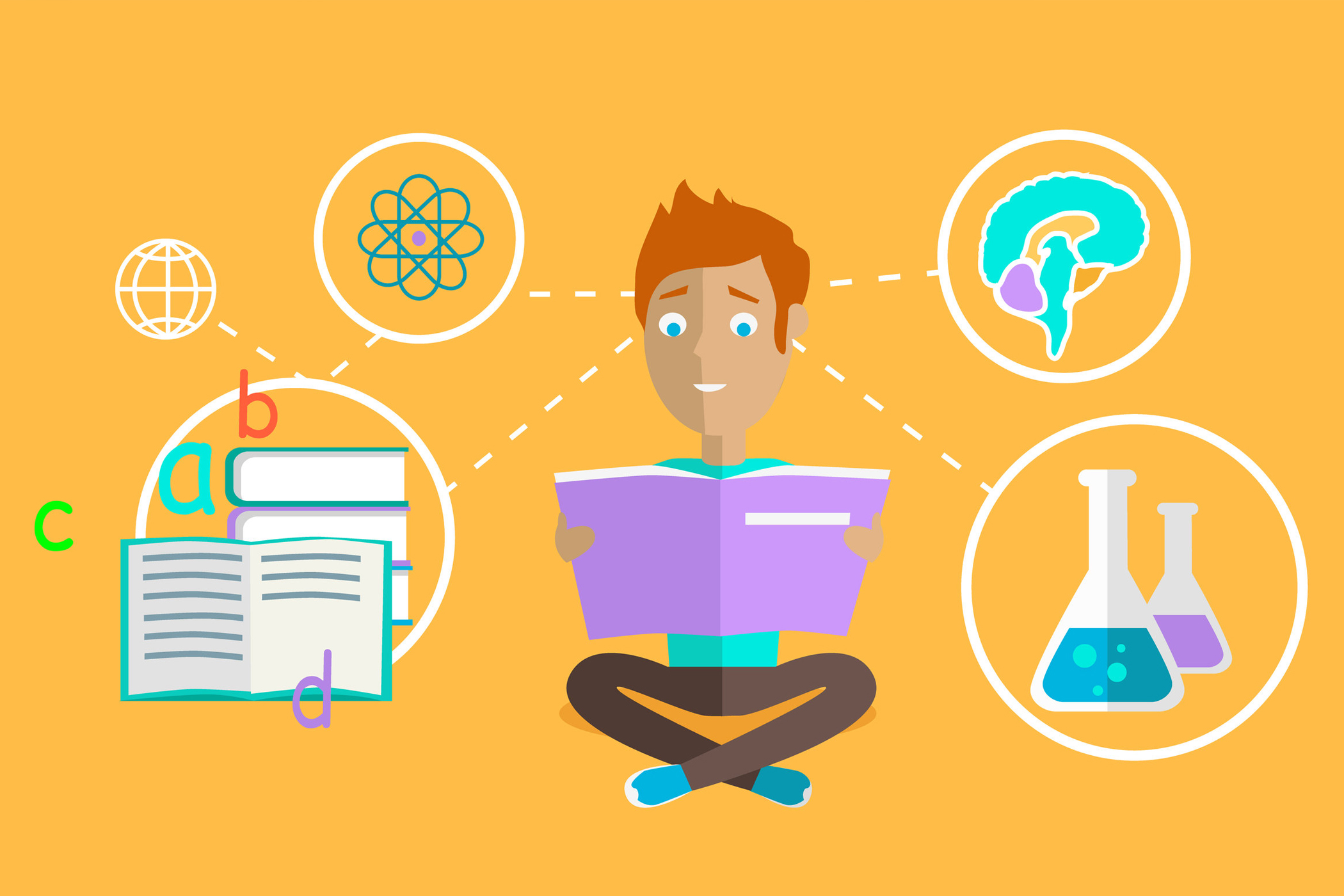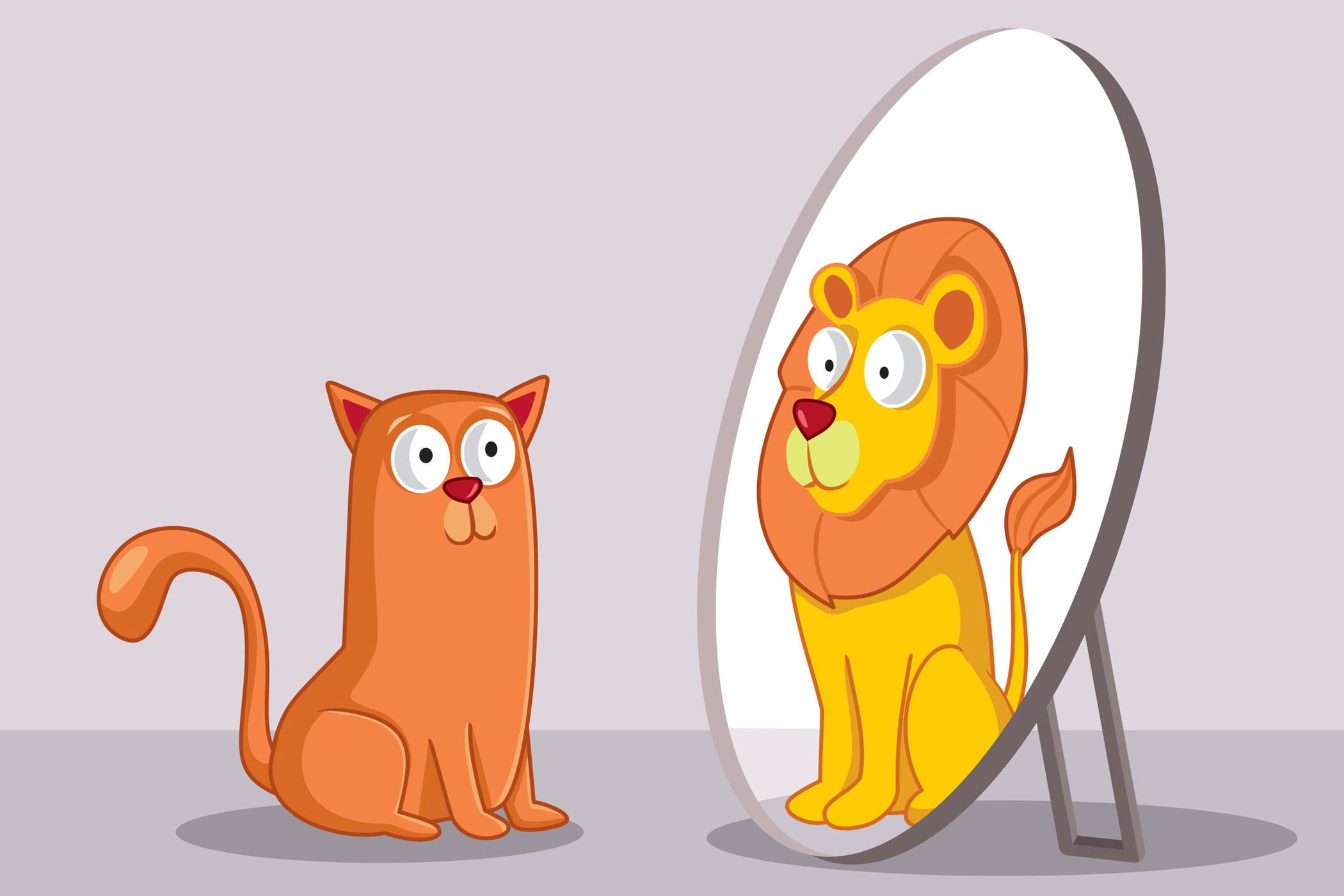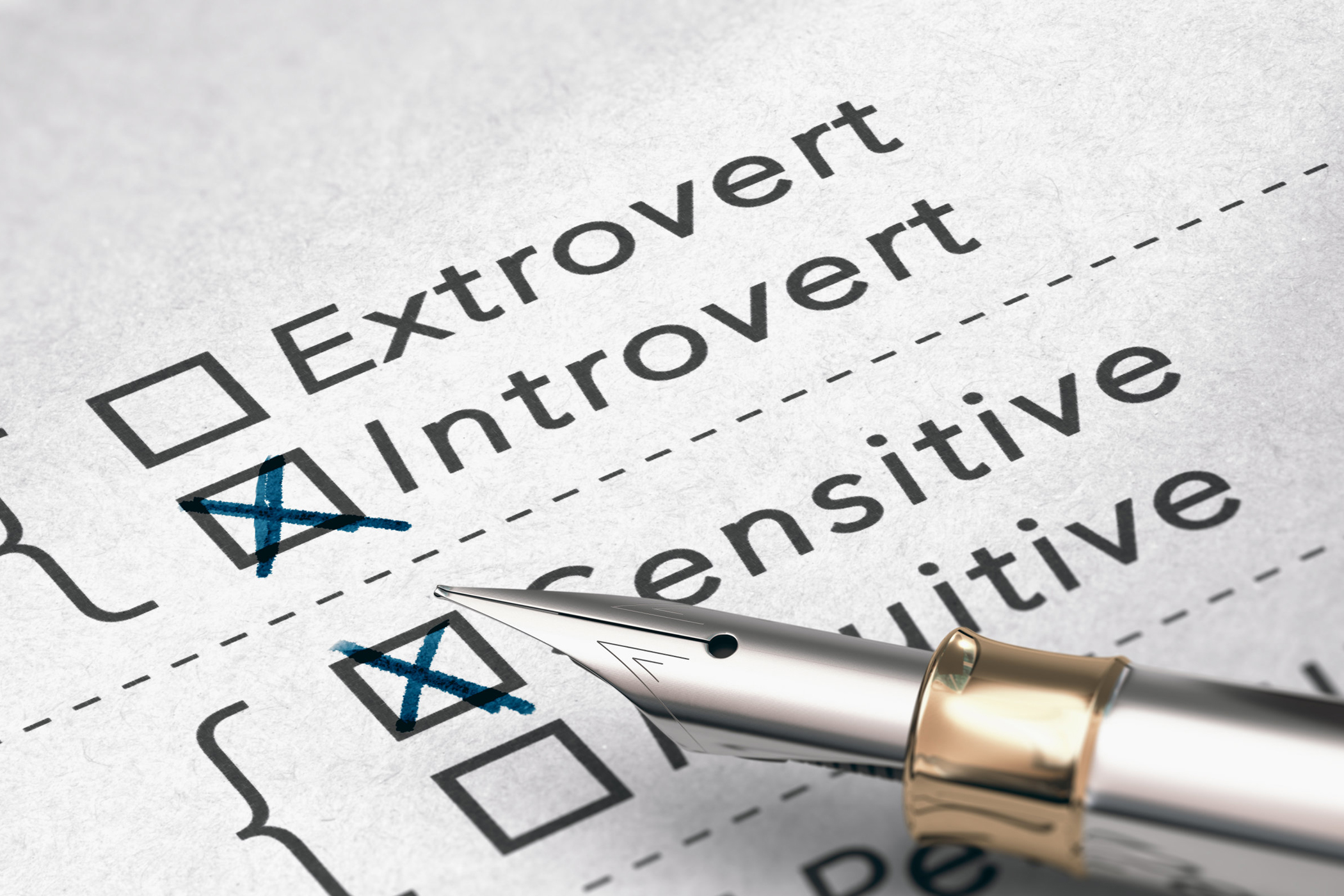Das Smartphone summt, der Kollege hat eine Frage – und schon ist der Arbeitsfluss unterbrochen, die Konzentration weg. Die Deep-Work-Methode verspricht Abhilfe. Doch was ist damit gemeint und wie wird Deep Work im Arbeitsalltag umgesetzt?Continue reading Deep Work: Tipps für mehr Konzentration bei der Arbeit
Smartphone ins Wasser gefallen: Was jetzt zu tun ist
Termine organisieren, schnelle Absprachen tätigen oder Notizen machen: Das Smartphone ist längst der feste Begleiter vieler Menschen. Umso ärgerlicher, wenn das Gerät plötzlich im Wasser landet! Die folgenden Tipps helfen gegen den Wasserschaden.Continue reading Smartphone ins Wasser gefallen: Was jetzt zu tun ist →
Mitarbeiterschulung: Lerntypen erkennen und besser fördern
Die Anleitung von Auszubildenden oder die Einarbeitung von neuen Kollegen: Es gibt viele Gründe, warum Mitarbeiter geschult werden. Damit das möglichst gut gelingt, ist es wichtig, zunächst den individuellen Lerntyp zu erkennen.Continue reading Mitarbeiterschulung: Lerntypen erkennen und besser fördern →
Debriefing: Das Wichtigste rund um die Einarbeitung des Nachfolgers
Verlässt ein Mitarbeiter das Unternehmen, nimmt er seine Erfahrungen und wichtiges Know-how mit sich. Hier kommt das sogenannte Debriefing ins Spiel: Es hilft dem Nachfolger, den Aufgabenbereich des ausscheidenden Mitarbeiters möglichst reibungslos zu übernehmen. Dabei gilt es, einige Punkte zu beachten. Was ist ein Debriefing? Der Begriff “Debriefing” stammt ursprünglich aus dem militärischen Bereich. DortContinue reading Debriefing: Das Wichtigste rund um die Einarbeitung des Nachfolgers →
4 wertvolle Tipps für den Umgang mit Headhuntern
In einem Artikel aus dem Jahr 2018 haben wir die Frage beantwortet Was macht ein Headhunter genau?. Darin haben wir beschrieben, was ein „Kopfjäger“ ist und was zu seinen Hauptaufgaben gehört. Im folgenden Text gehen wir einen Schritt weiter und geben Tipps für den Umgang mit Headhuntern.Continue reading 4 wertvolle Tipps für den Umgang mit Headhuntern →
Selbständig machen: Rechnungen, Buchhaltung, Steuern und Versicherungen (Artikelserie, Teil 7)
Zum Abschluss unserer siebenteiligen Artikelserie „Selbständig machen“ kümmern wir uns um eher bürokratische Themen: Rechnungen, Buchhaltung, Steuern und Versicherungen. Diese sind bei vielen Selbständigen zwar unbeliebt, für eine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens aber unabdingbar.Continue reading Selbständig machen: Rechnungen, Buchhaltung, Steuern und Versicherungen (Artikelserie, Teil 7) →
Selbstreflexion: Tipps, um die Selbstwahrnehmung im Job zu schärfen
Bei der Selbstreflexion geht es darum, die eigenen Wünsche, Emotionen und Handlungen zu hinterfragen. Ziel ist es, Erkenntnisse zu gewinnen und aufgrund derer an sich zu arbeiten. Besonders im stressigen Arbeitsalltag kann es wichtig sein, innezuhalten und die eigene Situation zu analysieren.Continue reading Selbstreflexion: Tipps, um die Selbstwahrnehmung im Job zu schärfen →
Gehaltserhöhung: So erkennen Angestellte, dass sie dafür bereit sind
Eine Gehaltserhöhung kommt meist nicht von allein. In der Regel müssen Angestellte sich aktiv darum bemühen und mit ihrem Arbeitgeber in Verhandlung treten. Doch wann ist dafür der passende Zeitpunkt gekommen? Woran erkennen Arbeitnehmer, dass das nächste Gehaltsgespräch fällig ist? Ein Überblick.Continue reading Gehaltserhöhung: So erkennen Angestellte, dass sie dafür bereit sind →
8 Tipps für die Gestaltung von Visitenkarten
„Visitenkarten sind doch diese gedruckten Kärtchen mit Kontaktinformationen … Braucht man die denn in unserer digitalisierten Geschäftswelt überhaupt noch?“
Diese Frage stellen sich viele Unternehmen. Unsere Antwort lautet: „Ja. Aber nur, wenn die Visitenkarte das Zeug dazu hat, dafür zu sorgen, dass man im Gedächtnis bleibt. Nur dann ist sie ein geeignetes Mittel, um persönliche Beziehungen zu Geschäftspartnern oder Kunden zu stärken.“Continue reading 8 Tipps für die Gestaltung von Visitenkarten →
Auf Online-Bewertungen richtig reagieren – 5 Tipps
Jedes Unternehmen, das im Internet in irgendeiner Form präsent ist, sollte sich früher oder später mit den Themen Online-Bewertungen und Online-Rezensionen auseinandersetzen. Mittlerweile informiert sich ein überwiegender Teil der Verbraucher über Google und sonstige Bewertungsportale in der Frühphase des Entscheidungsprozesses darüber, wie über einen Anbieter, ein Produkt oder eine Dienstleistung geurteilt wird.Continue reading Auf Online-Bewertungen richtig reagieren – 5 Tipps →
Selbstbewusst auftreten im Job: 3 Tipps für mehr Selbstsicherheit
Nicht jeder Mensch ist von Natur aus selbstsicher und extrovertiert. Für die Karriere kann ein selbstbewusstes Auftreten jedoch förderlich sein: Es hilft, sich in kniffligen Situationen zu behaupten. Mit folgenden Tipps lässt sich die selbstsichere Ausstrahlung trainieren.Continue reading Selbstbewusst auftreten im Job: 3 Tipps für mehr Selbstsicherheit →
Teamfähigkeit verbessern: Was das bedeutet und wie es gelingt
Bevor man daran geht, die eigene Teamfähigkeit zu verbessern, muss zunächst eine Frage geklärt werden: Was ist mit dem Begriff überhaupt gemeint? Was ist Teamfähigkeit und wie zeigt sie sich im Job? Teamfähige Menschen sind in der Lage, ihre Fähigkeiten in einer Gruppe so einzusetzen, dass das Team den größtmöglichen gemeinsamen Erfolg erreicht. Im BerufslebenContinue reading Teamfähigkeit verbessern: Was das bedeutet und wie es gelingt →
Mini-Retirement: Was ist das, was bringt es und wie gelingt es?
Ausbildung oder Studium, Berufsleben, Rente: Die klassische Abfolge ist heute längst nicht mehr der einzige mögliche Karriereweg. Bewusste Auszeiten werden immer beliebter. Dazu gehört auch das sogenannte Mini-Retirement. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?Continue reading Mini-Retirement: Was ist das, was bringt es und wie gelingt es? →
Klimaschutz im Büro
Der Klimawandel macht „Mutter“ Erde zu schaffen. Und Schuld daran sind ausgerechnet ihre „Kinder“, die zu lange nur an sich gedacht, natürliche Ressourcen verschwendet und den Planeten zugemüllt haben.
Die jüngsten Ereignisse aus dem Juli 2021 zeigen in drastischer Weise, dass die Zeit für weiteres Zögern definitiv vorbei ist. Die verheerenden Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, fatale Dürre und nie da gewesene Temperaturrekorde in Kalifornien, Teilen Kanadas und Sibirien sowie Horrornachrichten aus der Arktis und Antarktis über abtauenden Permafrost sind die Vorboten einer Zukunft, in der Klima und Wetter noch mehr verrückt spielen werden.Continue reading Klimaschutz im Büro →
Zurück zum alten Arbeitgeber – eine gute Idee?
Viele Arbeitnehmer können sich eine Rückkehr zum alten Arbeitgeber nicht vorstellen. Schließlich gab es gute Gründe für die Trennung: das sprichwörtlich „zerschnittene Tischtuch“, mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten oder unliebsame Kollegen bzw. Vorgesetzte.
Wer solche Gründe nicht hatte oder trotz allem zum ehemaligen Unternehmen zurückkehren möchte, sollte sich den Schritt gut überlegen. Wohl selten kommt es vor, dass ein „Boomerang-Arbeitnehmer“ nach einer längeren Abwesenheit so erfolgreich durchstartet wie Steve Jobs bei Apple.Continue reading Zurück zum alten Arbeitgeber – eine gute Idee? →
Persönlichkeitstests im Bewerbungsprozess
Durch Bewerbungsschreiben und Lebenslauf finden Personaler ziemlich schnell heraus, ob ein Bewerber die fachlichen Voraussetzungen erfüllt. Das Vorstellungsgespräch gibt dann Aufschluss darüber, wie es um die sozialen Fähigkeiten des Jobaspiranten steht. Aber ist der Bewerber tatsächlich am besten geeignet für die ausgeschriebene Stelle?
Um diese Frage so gut wie möglich zu beantworten, setzen viele Unternehmen auf Persönlichkeitstests. Schließlich möchte man Fehlbesetzungen unbedingt vermeiden, die zu hohen Kosten führen können.Continue reading Persönlichkeitstests im Bewerbungsprozess →
Mit Fehlentscheidungen richtig umgehen: 5 Tipps
Niemand ist vor einer Fehlentscheidung gefeit. Gerade deshalb ist es im Job besonders wichtig, professionell mit möglichen Folgen umzugehen. Mit diesen Tipps lässt sich das Beste aus der Situation machen.Continue reading Mit Fehlentscheidungen richtig umgehen: 5 Tipps →
Teamzusammenhalt stärken: So gelingt es – auch virtuell
Die Motivation im Team lässt gerade zu wünschen übrig? Das muss nicht so bleiben. Es gibt einige Möglichkeiten, um den Teamzusammenhalt zu stärken. Dazu sollte zunächst in einer anonymen Mitarbeiterbefragung oder im Gespräch mit dem Vorgesetzten die Stimmung im Team erfasst werden. Danach können die folgenden Maßnahmen für mehr Zusammenhalt sorgen.Continue reading Teamzusammenhalt stärken: So gelingt es – auch virtuell →
Online-Netzwerken im Berufsleben: Warum es sich lohnt und wie es gelingt
Berufserfahrung und relevante Qualifikationen sind für die Jobsuche gut, Kontakte innerhalb der Branche oder eines Unternehmens sind besser. Eine persönliche Empfehlung kann zum Traumjob oder der Austausch mit einem Branchenexperten zur neuen Geschäftsidee führen. Aufbauen lassen sich die nötigen Kontakte längst nicht mehr nur offline, sondern sehr gut auch online.Continue reading Online-Netzwerken im Berufsleben: Warum es sich lohnt und wie es gelingt →
Häufige Jobwechsel im Lebenslauf: Vor- und Nachteile des Jobhoppings
Wenn sich eine gute Gelegenheit bietet, sollte man diese ergreifen. Demnach ist erst einmal nichts falsch daran, den Job zu wechseln. Zu viel Jobhopping kann bei Personalern jedoch den Eindruck erwecken, dass der betreffende Bewerber sprunghaft oder unzuverlässig ist. Deshalb ist es wichtig, die Jobwechsel gut begründen zu können.Continue reading Häufige Jobwechsel im Lebenslauf: Vor- und Nachteile des Jobhoppings →