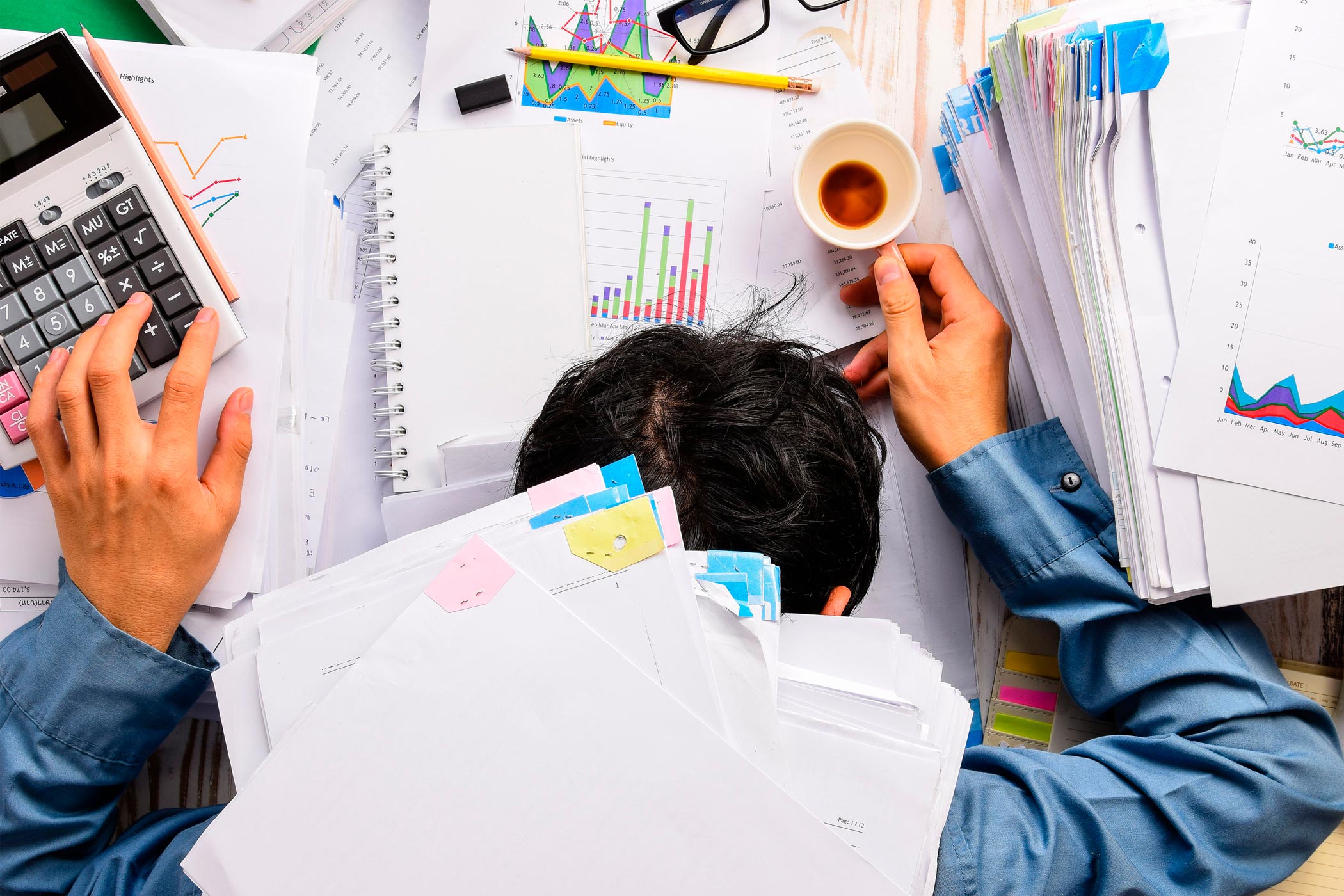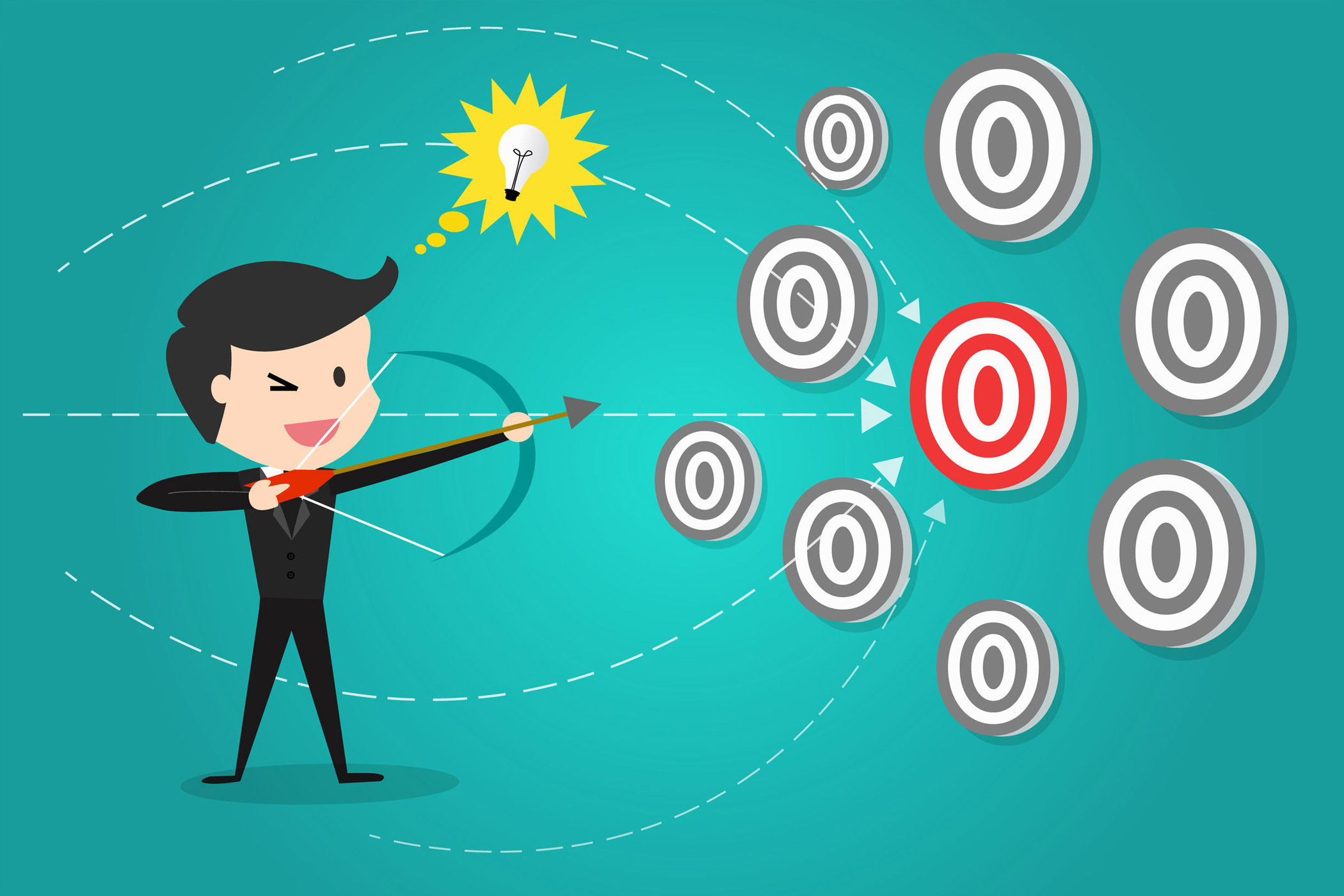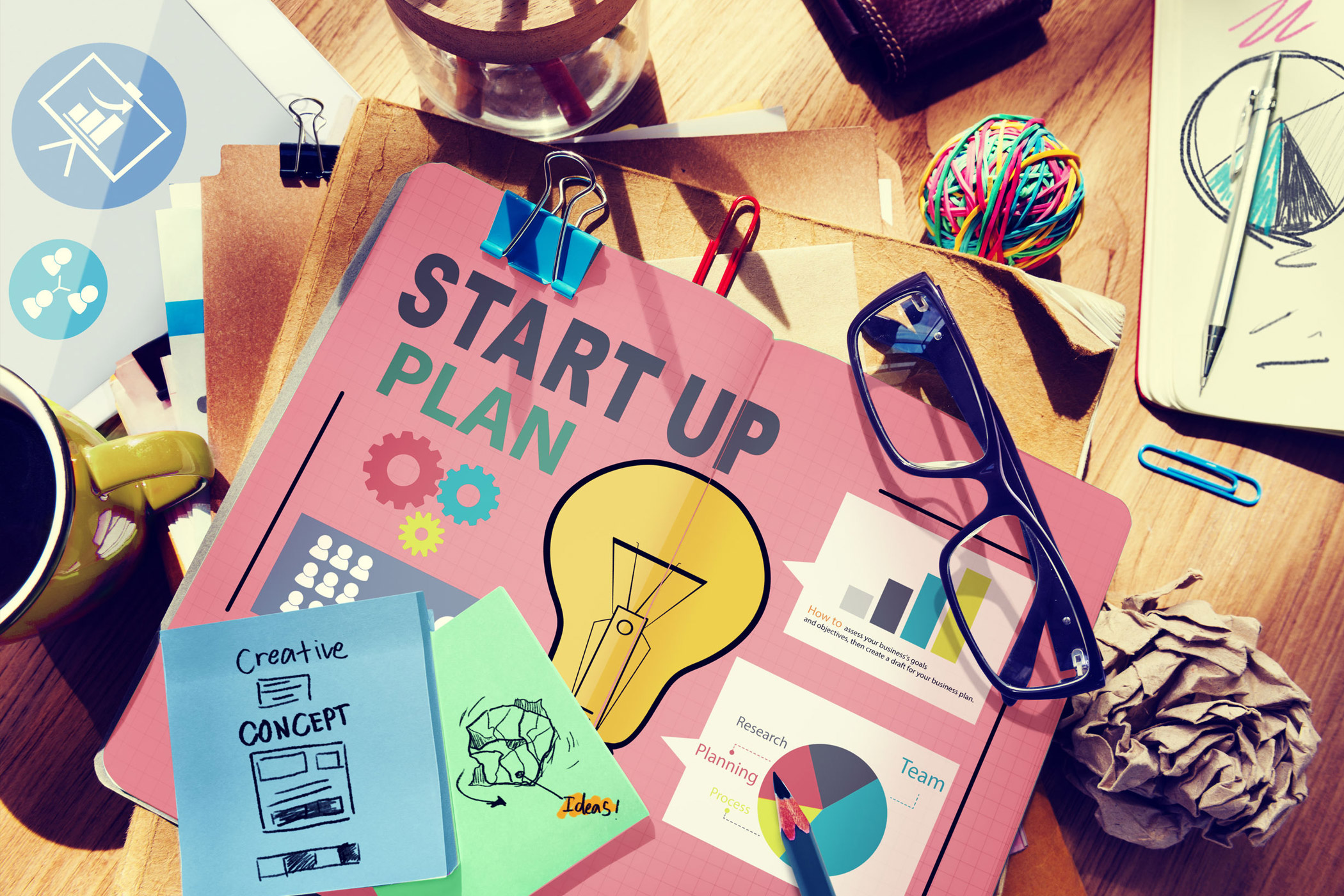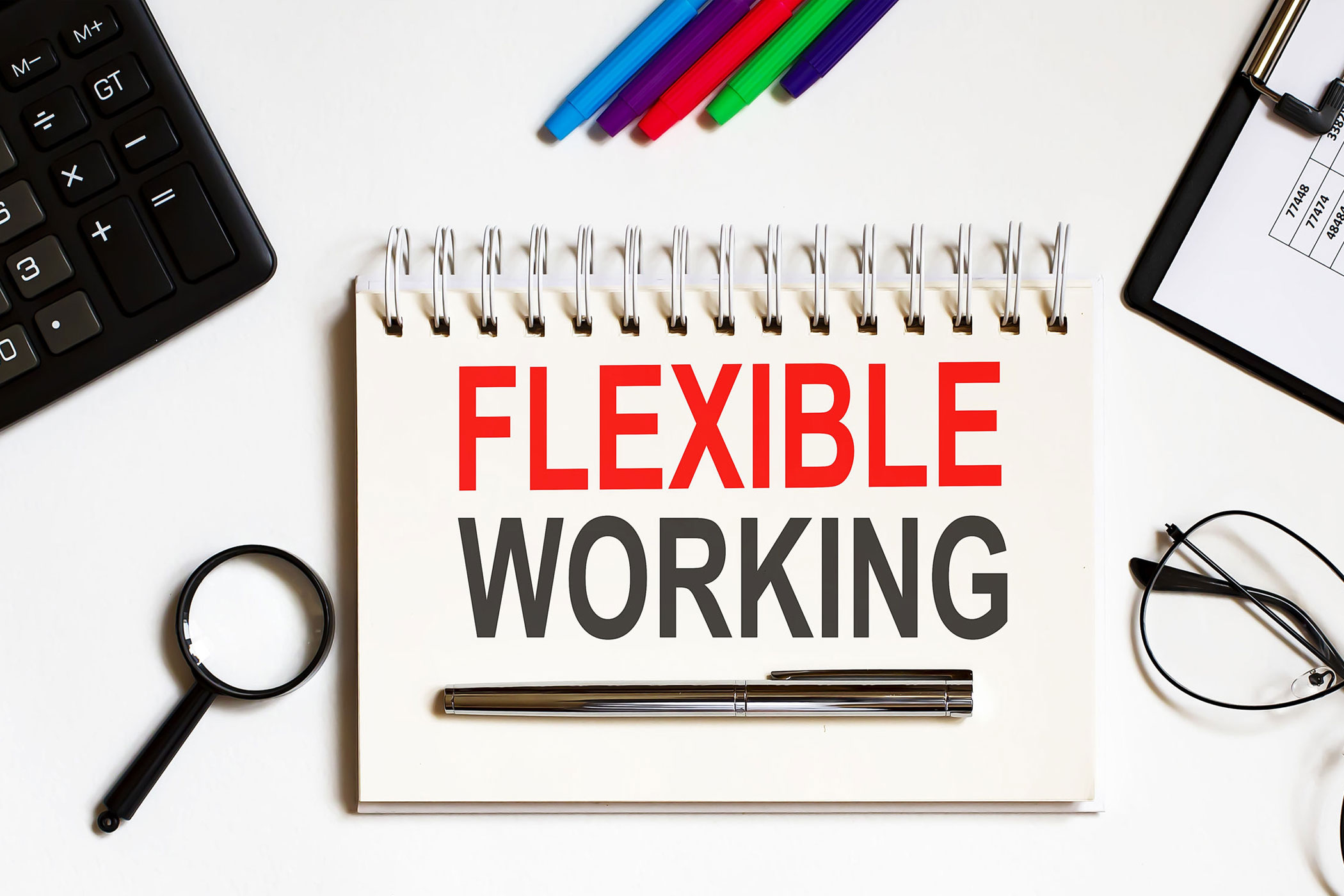Wenn der Arbeitstag angenehm beginnt, erledigen sich die Aufgaben gefühlt sehr viel schneller und einfacher. Schon kleine morgendliche Routinen können dabei helfen, die Motivation und Produktivität für den ganzen Tag zu steigern. Diese 5 Tipps funktionieren wie ein
Stimmungsbooster!
Continue reading Produktiv in den Tag starten: 5 Tipps für eine gesunde Morgenroutine