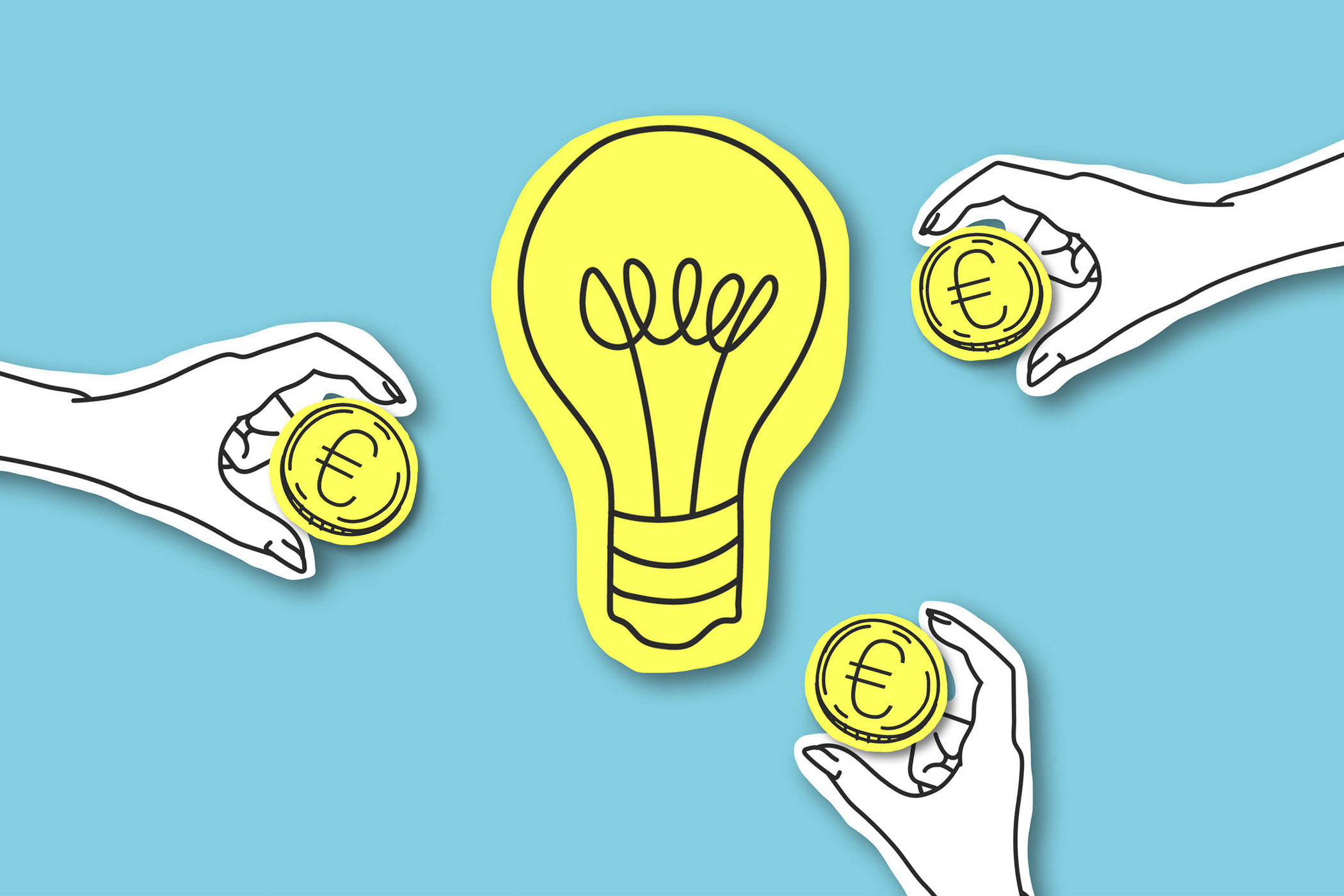Wenn sich eine gute Gelegenheit bietet, sollte man diese ergreifen. Demnach ist erst einmal nichts falsch daran, den Job zu wechseln. Zu viel Jobhopping kann bei Personalern jedoch den Eindruck erwecken, dass der betreffende Bewerber sprunghaft oder unzuverlässig ist. Deshalb ist es wichtig, die Jobwechsel gut begründen zu können.Continue reading Häufige Jobwechsel im Lebenslauf: Vor- und Nachteile des Jobhoppings
Psychische Gefährdungsbeurteilung: Wissenswertes rund um die Arbeitsschutzmaßnahme
Nicht nur körperlich sind Angestellte am Arbeitsplatz oft verschiedenen Gefahren wie Lärm oder defekten Stromquellen ausgesetzt. Auch psychische Belastungen können den Mitarbeitern eines Unternehmens schaden. Dazu gehören beispielsweise:
Eine ständige Über- oder Unterforderung durch Aufgaben, die den eigenen Fähigkeiten nicht entsprechen.
Stress durch hohen Zeitdruck oder viele Überstunden.
Schlechte soziale Strukturen durch ungelöste zwischenmenschliche Konflikte oder mangelnde Führungskompetenzen.
Frustration, wenn zum Beispiel erbrachte Leistungen zu wenig gewürdigt werden.
Als Folge dieser Belastungen können bei den Angestellten langfristig psychische Erkrankungen wie Burn-out oder Depressionen auftreten. Und auch kurzfristig zeigen sich bereits negative Auswirkungen: Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten gehören hierzu.Continue reading Psychische Gefährdungsbeurteilung: Wissenswertes rund um die Arbeitsschutzmaßnahme →
Selbständig machen: Marketing (Artikelserie, Teil 6)
Sich selbständig zu machen, ist ein komplexes Vorhaben. Gut, wenn man den einen oder anderen Tipp bekommt. Genau das machen wir mit unserer Artikelserie und haben uns bereits mit den folgenden Themen auseinandergesetzt: Gründertyp, Geschäftsidee, Rechtsformen, Businessplan und Finanzierung. In den nächsten Absätzen geht es nun um das Marketing. Denn was nützt die beste Geschäftsidee, wenn niemand davon weiß!?Continue reading Selbständig machen: Marketing (Artikelserie, Teil 6) →
Selbständig machen: Finanzierung, Förderungen und Gründerwettbewerbe (Artikelserie, Teil 5)
In unserer umfangreichen Artikelserie haben wir uns bereits mit dem Gründertyp, der Geschäftsidee, der Rechtsform und dem Businessplan beschäftigt. In diesem Beitrag geht es nun um die wichtige Frage: Wie kann man den Start in die Selbständigkeit am besten finanzieren?
Nur in seltenen Fällen haben Existenzgründer genügend Eigenkapital „auf der hohen Kante“. Alle anderen sind auf Fremdkapital und/oder Fördergelder angewiesen. Da man dieses auf vielen Wegen beschaffen kann, kratzen wir in unserem Artikel an der Oberfläche und blicken nur hier und dort genauer hin.
Auch mit der erfolgreichen Teilnahme an Existenzgründerwettbewerben kann man das Startkapital aufstocken. Daher haben wir das Thema mit aufgenommen.Continue reading Selbständig machen: Finanzierung, Förderungen und Gründerwettbewerbe (Artikelserie, Teil 5) →
Zoom Fatigue: Tipps gegen die Müdigkeit während der Videokonferenz
Wer schon einmal an vielen Online-Meetings hintereinander teilnehmen musste, weiß: Die virtuellen Besprechungen können die Teilnehmer belasten. Mal zerrt die schlechte Internetverbindung an den Nerven, ein anderes Mal ist schlicht das monotone Starren auf den Bildschirm kräfteraubend. Infolgedessen werden die Teilnehmer müde, gereizt und unkonzentriert. Für diesen Effekt gibt es einen Begriff: “Zoom Fatigue”. Dabei handelt es sich um eine Zusammensetzung aus dem Namen der Videokonferenz-Software Zoom und dem französischen Wort für Müdigkeit.Continue reading Zoom Fatigue: Tipps gegen die Müdigkeit während der Videokonferenz →
Körpersprache: So punkten Bewerber im Vorstellungsgespräch
In einem Vorstellungsgespräch präsentieren Bewerber sich selbst. Dabei kommt es nicht nur darauf an, was sie sagen, sondern auch, wie sie das Gesagte rüberbringen. Mimik, Gestik und Körperhaltung vermitteln Recruitern und Personalchefs einen ersten Eindruck von der Persönlichkeit des Bewerbers. Wer weiß, worauf er achten muss, kann seine eigene Körpersprache somit gezielt einsetzen, um sich selbst in das bestmögliche Licht zu rücken.Continue reading Körpersprache: So punkten Bewerber im Vorstellungsgespräch →
Einschlafrituale: Tipps für eine angenehme Nachtruhe
Guter Schlaf ist wichtig: Der Körper nutzt die Zeit, um sich zu erholen. Das Gehirn verarbeitet alle am Tag erhaltenen Informationen. Heißt wiederum: Menschen, die schlecht ein- oder durchschlafen können, haben am Folgetag weniger Energie und ihre Konzentrationsfähigkeit sinkt.
Simple Einschlafrituale helfen dem Körper, sich auf die Nachtruhe einzustellen und sich zu entspannen. Wichtig ist, dass sich die Rituale leicht in den Alltag integrieren lassen, damit sie regelmäßig durchgeführt werden. So gewöhnt sich der Körper schnell an den “Startschuss” zum Einschlafen.Continue reading Einschlafrituale: Tipps für eine angenehme Nachtruhe →
Mitarbeitergespräch meistern: Hilfreiche Tipps für Angestellte
Bei einem Mitarbeitergespräch blicken Angestellter und Führungskraft in der Regel gemeinsam auf vergangene Aufgaben und Projekte zurück: Sie besprechen, was gut gelaufen ist und was nicht. Zudem werden persönliche Entwicklungsmöglichkeiten erörtert. In dem Gespräch geht es somit darum, Probleme zu lösen, Konflikte zu vermeiden und Mitarbeiter zu fördern. Damit das gelingt, sollten Angestellte folgende Tipps beherzigen.Continue reading Mitarbeitergespräch meistern: Hilfreiche Tipps für Angestellte →
Gehaltsgespräch: 8 Dinge, die Angestellte auf keinen Fall sagen sollten
Es steht ein Gehaltsgespräch an? Das ist für viele Arbeitnehmer eine aufregende Situation. Doch wer sich richtig vorbereitet, kann dem Termin mit dem Chef gelassen entgegensehen. Neben einem gesunden Selbstbewusstsein hilft es, wenn die folgenden Aussprüche absolut tabu sind.Continue reading Gehaltsgespräch: 8 Dinge, die Angestellte auf keinen Fall sagen sollten →
Selbständig machen: Der Businessplan (Artikelserie, Teil 4)
Nachdem wir in den ersten drei Artikeln einen Blick auf den Gründertyp, die Geschäftsidee und die Rechtsform geworfen haben, widmen wir uns nun dem Businessplan. Dieser ist vor allem in der Frühphase der Gründung von immenser Bedeutung.
Im Businessplan wird die Geschäftsidee formuliert und das Konzept detailliert beschrieben. Somit dient er dem Gründer selbst als Wegweiser und einem möglichen Geldgeber als Basis für seine Überlegungen.Continue reading Selbständig machen: Der Businessplan (Artikelserie, Teil 4) →
Selbständig machen: Rechtsform des Unternehmens (Artikelserie, Teil 3)
Wer ein Gründertyp ist und die passende Geschäftsidee gefunden hat, muss sich im nächsten Schritt darüber Gedanken, welche Rechtsform er wählt. Diese Entscheidung ist sehr wichtig, da die Rechtsform den formalen und rechtlichen Rahmen des Unternehmens vorgibt. Im folgenden Artikel skizzieren wir die gängigsten Rechtsformen in Deutschland und nennen die jeweiligen Vorteile und Nachteile.Continue reading Selbständig machen: Rechtsform des Unternehmens (Artikelserie, Teil 3) →
Fit fürs Vorstellungsgespräch: Eigene Stärken und Schwächen kennen und richtig formulieren
Jeder Mensch ist anders, hat eigene Stärken und Schwächen – doch nicht jeder ist sich derer auch konkret bewusst. Spätestens beim Vorstellungsgespräch sind Bewerber jedoch meist gezwungen, ihre persönlichen Stärken und Schwächen zu kommunizieren. Dabei helfen ein wenig Vorbereitung und die folgenden Tipps.Continue reading Fit fürs Vorstellungsgespräch: Eigene Stärken und Schwächen kennen und richtig formulieren →
Jobangebot: Erfolgreicher Verhandeln mit diesen Tipps
Künftiger Aufgabenbereich, wöchentliche Arbeitszeit, Wunschgehalt: Schon während des Bewerbungsprozesses kommen erste Vertragsdetails zur ausgeschriebenen Stelle zur Sprache. Doch erst wenn das Jobangebot auf dem Tisch liegt, geht es an die konkreten Verhandlungen für den Arbeitsvertrag. Mit ein paar Tipps holen Bewerber das meiste für sich heraus.Continue reading Jobangebot: Erfolgreicher Verhandeln mit diesen Tipps →
Den Chef lenken: Mit diesen 5 Tipps klappt es
Ganz klar: Der direkte Vorgesetzte hat das letzte Wort. Doch manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, wenn Angestellte ihrem Chef bei der Entscheidungsfindung subtil etwas unter die Arme greifen. Cheffing, also die Führung von unten, kann dazu beitragen, die Führungsarbeit insgesamt zu verbessern – was am Ende nicht nur dem Ergebnis, sondern auch den Arbeitsbedingungen zugutekommt.Continue reading Den Chef lenken: Mit diesen 5 Tipps klappt es →
Bewerbungsgespräch: 5 Tipps von Models für gelungenes Auftreten
Der erste Eindruck zählt: Das gilt im Alltag genauso wie im Bewerbungsgespräch. Wer auf der Suche nach einem neuen Job ist, kann sich hier eine Scheibe von professionellen Models abschneiden. Wie andere Arbeitnehmer im Vorstellungsgespräch, müssen sie bei Castings auf den ersten Blick überzeugen. Da ist gekonntes Auftreten gefragt.Continue reading Bewerbungsgespräch: 5 Tipps von Models für gelungenes Auftreten →
Umschulung: Was es zur beruflichen Weiterbildung zu wissen gibt
Eine Umschulung ist eine Form der Aus- oder Weiterbildung. Durch sie qualifiziert sich eine Person, die bereits einen Beruf erlernt hat, für einen Job in einem anderen Berufsfeld. Eine berufliche Neuorientierung kann die unterschiedlichsten Gründe haben.
Continue reading Umschulung: Was es zur beruflichen Weiterbildung zu wissen gibt →
Elterngeld – alle wichtigen Informationen (Artikelserie, Teil 3)
Im ersten Teil der Artikelserie haben wir uns mit der rechtlichen Grundlage, den Zielen, den Voraussetzungen und dem Antragsverfahren beschäftigt. Im zweiten Teil folgten Informationen über die Höhe des Elterngeldes, die Berechnung und Dauer sowie das Elterngeld Plus und andere Bonusregeln. Im dritten und abschließenden Teil geben wir Tipps, mit denen man das Elterngeld erhöhen kann, informieren über Änderungen während der Corona-Pandemie und antworten auf häufig gestellte Fragen.Continue reading Elterngeld – alle wichtigen Informationen (Artikelserie, Teil 3) →
Arbeitsmoral steigern: Mit diesen Tipps gelingt es
Mit dem Begriff “Arbeitsmoral” wird die Haltung der Mitarbeiter gegenüber ihrer eigenen Arbeit beschrieben. Eine schlechte Arbeitsmoral bedeutet etwa, dass die Mitarbeiter unmotiviert und unzufrieden mit ihrer Tätigkeit sind. Daraus folgen oft zum Beispiel Stress, schlechte Stimmung und eine hohe Krankheitsquote im Unternehmen. Eine hohe Arbeitsmoral hingegen führt in der Regel dazu, dass die Mitarbeiter produktiver werden und dem Unternehmen aktiv zum Erfolg verhelfen wollen, beispielsweise indem sie neue Ideen beisteuern.Continue reading Arbeitsmoral steigern: Mit diesen Tipps gelingt es →
Branche wechseln: In diesen drei Fällen lohnt sich die Umorientierung
Wer nicht mehr mit seinem Job glücklich ist oder schlicht keine passende Stelle in seinem Berufsfeld findet, steht früher oder später vor der Frage: “Sollte ich die Branche wechseln?” Keine leichte Entscheidung. Schließlich müssen Quereinsteiger sich oft völlig neues Wissen aneignen, vielleicht sogar eine zusätzliche Ausbildung absolvieren.
In den folgenden Fällen kann sich dieser Aufwand jedoch durchaus bezahlt machen.Continue reading Branche wechseln: In diesen drei Fällen lohnt sich die Umorientierung →
Arbeitstermin absagen oder verschieben: So macht man es richtig
Manchmal lässt es sich nicht vermeiden: Man muss einen längst vereinbarten Termin absagen oder auf einen anderen Zeitpunkt verschieben. Um Kollegen, Geschäftspartner oder Kunden nicht zu verärgern, sollte man dabei jedoch mit viel Feingefühl vorgehen.Continue reading Arbeitstermin absagen oder verschieben: So macht man es richtig →